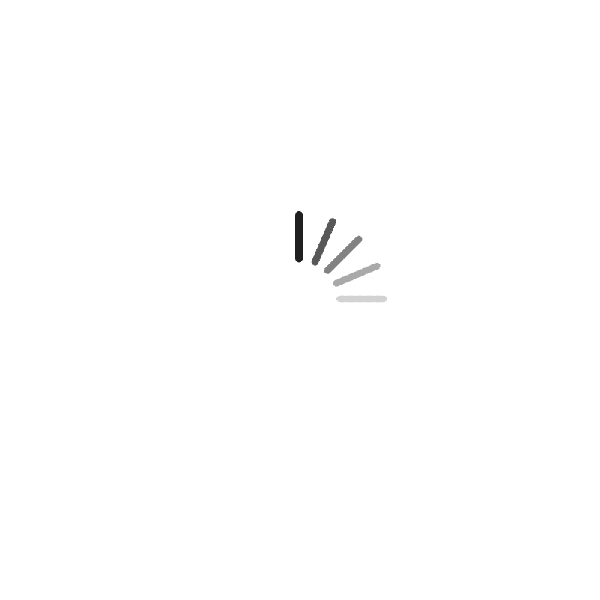Luise Adelgunde Victorie Gottsched, 1713–1762
Luise Gottscheds Übersetzungen können als wichtiger Beitrag zur Vermittlung zentraler Texte der Aufklärung und der französischen und englischen Literatur für ein deutsches Publikum betrachtet werden. Sie übersetzte literarische, philosophische, journalistische, geistes- und naturwissenschaftliche Texte aus dem Französischen und Englischen, u.a. Werke von Molière, Bayle, Voltaire, Destouches, Fénelon, Addison und Pope sowie von zahlreichen weniger bekannten Autoren und Autorinnen. Darüber hinaus verfasste sie eigene literarische Werke, insbesondere Dramen.
Luise Adelgunde Victorie Kulmus wurde am 11. April 1713 in Danzig geboren. Ihr Vater war Arzt und Naturwissenschaftler, ihre Mutter war literarisch sehr interessiert und brachte die Tochter früh mit der französischen Sprache und Literatur in Kontakt. Kenntnisse des Englischen erwarb sie durch ihren Halbbruder. Bereits in Danzig fertigte sie erste Übersetzungen an. 1729 lernte sie Johann Christoph Gottsched kennen, den sie 1735 heiratete und dem sie nach Leipzig folgte. Viele ihrer in der Folgezeit in Leipzig entstandenen Übersetzungen kamen in enger Kooperation mit ihrem Ehemann zustande, der als Professor an der Universität Leipzig lehrte, mehrfach Rektor der Universität war und durch seine zahlreichen Publikationen zu Literatur, Sprache, Rhetorik und Philosophie zeitlebens einen hohen Bekanntheitsgrad genoss. Auch mit anderen Mitgliedern des Leipziger Gottsched-Kreises bestand ein reger Austausch. Ein Schüler ihres Ehemanns gab ihr Lateinunterricht, was für Frauen der damaligen Zeit eine große Ausnahme war. Sie wirkte an verschiedenen Projekten ihres Ehemanns mit, u. a. an mehreren Zeitschriften, zu denen sie Übersetzungen und Rezensionen beisteuerte (vgl. Ball 2000: 171ff.). Bei manchen Texten aus dem Hause Gottsched ist die Autorschaft unsicher, zumal Gottsched selbst in seinem ausführlichen Nachruf auf seine Ehegattin angab, dass diese als ‚Ghostwriter‘ für ihn tätig gewesen sei: „Oft hat sie sogar meinen Briefwechsel in meinem Namen gefuehret, und sehr vielen Gelehrten das noethige beantwortet, wenn ich mit Geschaefften zu sehr ueberhaeufet war“ (J.Ch. Gottsched 1980 [1763]: 582). Luise Gottsched starb am 26. Juni 1762 in Leipzig, nur 49 Jahre alt.
Aufgrund der beruflichen Tätigkeit ihres Ehemannes hatte sie keine Reisen in jene Länder unternommen, deren Literatur sie über Jahrzehnte hin übersetzte. Ein wichtiger Aspekt der Horizonterweiterung für Luise Gottsched war daher der persönliche Kontakt und der Briefwechsel mit Freundinnen außerhalb des engeren Gottsched-Kreises, insbesondere mit Dorothea Henriette von Runckel sowie Charlotte Sophie Gräfin Bentinck, deren Bedeutung erst kürzlich von der Forschung entdeckt wurde (vgl. Goodman 2009). Die Ehe mit Johann Christoph Gottsched wurde in den letzten, von Krankheit geprägten Lebensjahren Luise Gottscheds, immer schwieriger, wie ihre Briefe belegen: „Johann Christoph Gottscheds Ideal einer geschickten Gehülfinn an seiner Seite und Louise Kulmus’ Entwurf einer auf Gleichberechtigung beruhenden Ehe waren unvereinbar“, schreibt Inka Kording, die den Briefwechsel mit D. von Runckel neu herausgegeben hat (in: L. Gottsched 1999: 12f).
Das übersetzerische Gesamtwerk von Luise Gottsched ist schon allein hinsichtlich des Umfangs beachtlich. Die Bibliographie der Erstausgaben enthält 36 Einträge zu Übersetzungen, davon 22 in Buchform, die sich wiederum auf über 40 Bände verteilen. Allein die Geschichte der königlichen Akademie der Schönen Wissenschaften zu Paris umfasst zehn von ihr übersetzte Bände. Beachtlich ist auch die Vielfalt der Gattungen und Themengebiete, wie Hilary Brown in ihrer exzellenten Studie Luise Gottsched the Translator betont: „She turned her hand chiefly to contemporary French and English works, rendering texts into German across an extraordinary range of genres and disciplines, from poetry and drama to philosophy, history, archaeology, and theoretical physics“ (Brown 2012: 1).
Die Wahl eines zu übersetzenden Werkes ging häufig auf einen Vorschlag von J. Ch. Gottsched zurück, der die Übersetzungstätigkeit seiner Ehefrau als wichtigen Bestandteil seines Programms zur Vermittlung der französischen (und englischen) Aufklärung und der von ihm geplanten Reform des Theaters in Deutschland betrachtete. Der Briefwechsel zwischen beiden zeigt jedoch, dass Luise keineswegs alle Vorschläge aufgriff und frühzeitig eigene Präferenzen entwickelte und pflegte (vgl. Pailer 1998: 52).
Bekannt wurde Luise Gottsched insbesondere für ihre Übersetzungen und Bearbeitungen französischer und englischer Theaterstücke (vor allem Komödien), sowie für einige Komödien, die häufig als eigenständige Werke behandelt wurden, sich bei näherer Analyse jedoch als Übersetzungen und Bearbeitungen französischer oder englischer Dramen erweisen (vgl. Brown 2012: 184ff.). Um einen Einblick in diesen Teil ihres Schaffens zu geben, werden im Folgenden einige dieser Übersetzungen exemplarisch vorgestellt. Vollständige bibliographische Angaben zu den insgesamt zwölf Dramenübersetzungen, von denen allein neun in J. Ch. Gottscheds Zeitschrift Die Deutsche Schaubühne erschienen, finden sich in der Bibliographie.
Ihre erste veröffentlichte Dramenübersetzung, Cato, ein Trauerspiel. Aus dem Englischen des Herrn Addisons übersetzt, erschien 1735 in Leipzig bei dem befreundeten Verleger Bernhard Christoph Breitkopf. Im Unterschied zu den späteren Übersetzungen handelt es sich um eine Tragödie. Diese erste vollständige Übersetzung von Addisons Drama ins Deutsche ist in Prosa gehalten, d.h. nicht in reimlosen Versen, wie sie J.Ch. Gottsched propagierte, der 1732 eine Teilübersetzung in dieser Form vorgelegt hatte. In ihrer Vorrede schreibt die Übersetzerin, „daß derjenige Poet noch erst gebohren werden soll, der diesen Cato auf solche Art [scil. in Versen] uebersetzen sollte“. Nach Einschätzung von G. van Gemert handelt es sich bei dieser Übersetzung noch nicht um eine „literarische“ Übersetzung im engeren Sinne, sondern lediglich um eine „Verständnishilfe“ (Van Gemert 1983: 200), was sich auch darin zeige, dass die Übersetzung nicht in J. Ch. Gottscheds Deutsche Schaubühne aufgenommen wurde.
Sechs Jahre nach Addisons Cato übersetzte Luise Gottsched für die Schaubühne ein weiteres Theaterstück, das auf Addison zurückgeht, dieses Mal eine Komödie: Das Gespenst mit der Trommel oder der wahrsagende Ehemann, ein Lustspiel des Herrn Addisons, nach dem Franzoesischen des Herrn Destouches uebersetzt. Es handelt sich also um eine „Übersetzung aus zweiter Hand“ (vgl. Stackelberg 1984: 125ff). Im Unterschied zu anderen Übersetzungen dieses Typs wird jedoch im Titel angegeben, dass nicht der englische Originaltext, sondern die französische Version Destouches’ als Vorlage diente. Ebenfalls untypisch für das Genre ist die Tatsache, dass es keine sprachlichen Gründe für den Umweg über die französische Version gab, denn Englisch beherrschte Luise Gottsched sehr gut. Der Grund für das Verfahren liegt vielmehr darin, dass J. Ch. Gottsched aus poetologischen Gründen die französische, nach der klassizistischen Norm verfasste Version präferierte, wie er in der Einleitung zur Schaubühne schrieb:
Herr Destouches hat zweifelsfrey in seiner französischen Übersetzung das englische Original in vielen Stücken verlassen oder verändert; um demselben die Ordnung und Regelmässigkeit zu geben, der die Engländer in ihren Schauspielen nicht gewohnt sind. Die Übersetzerinn hat sich also lieber nach dieser Verbesserung als nach dem Grundtexte richten wollen; da es ihr sonst eben so leicht gefallen wäre, diesen, als jenen zu übersetzen. (J. Ch. Gottsched [1741], zit. nach Stackelberg 1984: 126)
1742, ein Jahr nach der Addison-Destouches-Übersetzung und weiteren Dramenübersetzungen aus dem Französischen, erschien mit Molières Menschenfeind die Übersetzung eines Klassikers in der Schaubühne. Diese Übersetzung trägt die Züge einer Einbürgerung und Popularisierung, mit Blick auf ein breites deutsches Publikum. So finden sich in der deutschen Fassung nicht nur deutsche statt der französischen Eigennamen, sondern vor allem auch umgangssprachliche Redewendungen, die keine Entsprechung im Originaltext haben: „Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher“ wird zu „Man kann die Leute doch aber wohl anhören, ohne dass einem gleich die Galle überlaufen darf,“ und aus „Que me veut cette femme?“ wird „Was zum Henker will sie denn hier?“ In der älteren Sekundärliteratur, von Schlenther (1886) bis Richel (1973), wird die Übersetzung für diese Senkung des Stilniveaus zuweilen scharf kritisiert: „The coarsened mode of speech, which persists throughout the entire translation, is responsible for the utter failure of Frau Gottscheds’s effort“ (Richel 1973: 68). G. Blaikner-Hohenwart betont dagegen, dass die Anpassungen „intentional vorgenommen wurden“ und dem einbürgernden Übersetzungsideal der Aufklärung entsprächen, wie es von J. Ch. Gottsched vertreten wurde. Daher stelle „diese Übersetzung die erste Umsetzung zeitgenössischer Übersetzungstheorien dar“ (Blaikner-Hohenwart 2001: 70). Und H. Brown gibt zu bedenken, dass es im deutschen Sprachraum der Zeit weder eine soziale Entsprechung der Pariser Salonkultur noch eine sprachliche Entsprechung des klassischen Französisch gegeben habe: „There was not even an appropriate form of German to put in the mouth of baronesses and marquises: in Germany at this time the upper classes still preferred to use French and had not cultivated sophisticated forms of the native tongue“ (Brown 2012: 117).
Weitaus mehr Aufsehen als die bereits erwähnten Übersetzungen erregte die 1736 veröffentlichte Übersetzung einer Komödie eines wenig bekannten Autors: Guillaume Hyacinthe Bougeant, der sich in La Femme docteur ou la théologie janséniste tombée en quenouille (1732) über die französischen Jansenisten mokiert hatte. Luise Gottsched, die sich bei der Lektüre des Stückes an die deutschen Pietisten erinnert fühlte, passte die Handlung an Verhältnisse im pietistisch dominierten Preußen an und nannte ihre Version Die Pietisterey im Fischbein-Rocke; Oder die doktormäßige Frau. In einem Lust-Spiele vorgestellet. Aufgrund des religionskritischen Inhalts erschien die Übersetzung anonym. Als Verlagsort wurde Rostock statt Leipzig angegeben. Ein weiteres Ablenkungsmanöver findet sich in einem Brief J. Ch. Gottscheds vom Oktober 1736, in dem ein Hamburger Lutheraner als möglicher Verfasser ins Spiel gebracht wird: „Vergangene Messe ist eine geistliche Comödie hier verkaufet worden: Die Piesterey im Fischbein Rocke, genannt. Ich weis nicht, ob es rathsam sey theologische Dinge so lustig vorzutragen. Man sagt, Neumeister habe sie gemacht“ (J. Ch. Gottsched: Briefwechsel, Bd. 4: 205). Die Vorsicht war nicht unbegründet, denn die Übersetzung wurde verboten. C. Flottweil, ein Korrespondent Gottscheds, schrieb diesem im April 1738 aus Königsberg, wo die Handlung der Übersetzung spielt: „Die Pietisterey ist hier so scharff verboten, daß nur noch die Verbrennung vom Hencker fehlt“ (J. Ch. Gottsched: Briefwechsel, Bd. 5: 90). Die spätere Rezeption des Stückes ist zwiegespalten: Der französische Philologe A. Vulliod kommt aufgrund eines systematischen Vergleichs zwischen Ausgangs- und Zieltext zu dem Schluss, dass die Pietisterey als Übersetzung betrachtet voller Fehler sei (vgl. Vulliod 1912: 80). In der deutschsprachigen Sekundärliteratur wird Luise Gottscheds Stück, wie andere ihrer Komödien, häufig als Werk der Zielliteratur betrachtet, genauer gesagt als Vertreter der „sächsischen Typenkomödie“.1Die 1968 u. ö. in der Reclam-Universalbibliothek (Bd. 8579) erschienene Ausgabe des Stücks nennt auf dem Titelblatt nur Luise Gottsched als Verfasserin. Im Nachwort von Wolfgang Martens heißt es jedoch: „Die Gottschedin hat ein französisches Stück […] in toto übernommen und nur, freilich sehr geschickt, auf deutsche Verhältnisse eingerichtet. Von einem deutschen ‚Original’ wird man, wenn man den Paralleldruck der Pietisterey mit der Femme Docteur bei A. Vulliod studiert hat, schwerlich sprechen können“ (Martens 1979: 157f.). R. Krebs betrachtet die Adaptation an deutsche Verhältnisse als gelungen:
Indem die Gottschedin den Spieß gegen die ihr verhaßten Pietisten kehrt, bleibt sie dem Geist des Stückes treu. Die Handlung spielt jetzt im pietistischen Königsberg, und die Komödie verspottet den Anspruch auf Gelehrsamkeit und Theologie der dortigen vom Pietismus angesteckten Bürgersfrauen, während der Pietist Scheinfromm die Rolle des jansenistischen Betrügers übernimmt. Bis ins Detail werden die Einzelheiten der Originalfassung der deutschen Realität angepaßt. (Krebs 1993: 96)
Die Übersetzung von Dichtung nimmt im Œuvre von Luise Gottsched eine weniger zentrale Rolle ein. Am bekanntesten ist ihre 1744 veröffentlichte Übersetzung von Alexander Popes Gedicht Rape of the Lock. V. Richel zitiert in ihrer detaillierten Analyse des Lockenraub[s] eine Reihe von Flüchtigkeitsfehlern und stilistischen Ungeschicklichkeiten. So geht im folgenden Vers das Zeugma, ein typisches Stilmittel Popes, verloren: „Dost sometimes counsel take – and sometimes tea.“ – „Pflegst du oftmals Rath zu hören, und zuweilen trinkst du Thee“ (zit. nach Richel 1973: 77f.). An anderen Stellen bleibt die gleiche Figur jedoch erhalten: „Or stain her honor or her new brocade“ – „Wird vielleicht ihr Ruhm beflecket, oder ihr neu goldnes Kleid?“ (ebd.: 78). Ein ähnlich gemischtes Bild bietet sich bei anderen charakteristischen Merkmalen von Popes Dichtung. Dennoch kommt Richel insgesamt zu einer positiven Einschätzung der Übersetzung: „In spite of its various shortcomings, Frau Gottsched’s translation of The Rape of the Lock consitutes a most admirable performance“ (Richel 1973: 83). Kritisch äußert sich A. Poltermann, der Luise Gottscheds Text als Übersetzung aus zweiter Hand qualifiziert, da die Übersetzerin in ihrer Vorrede gestanden habe, „eine erste versifizierte Fassung auf der Grundlage einer französischen Prosaübersetzung angefertigt zu haben“ (Poltermann 1987: 35). Demgegenüber wendet H. Brown ein, dass die Pope-Übersetzung – gemeinsam mit anderen Übersetzungen aus dem Englischen – gerade dazu gedient habe, der französischen Hegemonie entgegenzuwirken (vgl. Brown 2012: 150f.).
Neben den literarischen Übersetzungen spielt die Übersetzung von Sach- und Fachliteratur aus unterschiedlichen Gebieten eine wichtige Rolle in Luise Gottscheds übersetzerischen Schaffen. Ihre erste veröffentlichte Übersetzung (1731) waren die Neue[n] Betrachtungen über das Frauenzimmer der Marquise de Lambert, einer bekannten Vertreterin der Pariser Salon-Kultur. Ein Brief der 17-Jährigen Luise Kulmus an J.Ch. Gottsched wirft ein Licht auf die Entstehung der Übersetzung:
Die Bücher, die Sie mir zu lesen empfehlen, sind vortreflich. Ein Fenelon, ein Fontenelle haben sich viel Mühe gegeben, unser Geschlecht zu unterrichten und zu bessern. Vorzüglich aber gefällt mir die Marquise de Lambert. Welche unvergleichliche Mutter! Sie lehrt ihre Tochter nicht auf den äußerlichen Reiz ihrer Jugend, ihres Geschlechts sich zu verlassen, sondern ihr Herz zu bilden, ihren Verstand aufzuklären, und sich wirkliche Vorzüge zu verschaffen. Ich werde Ihrem Rathe folgen, und mich an die Uebersetzung wagen. (J. Ch. Gottsched, Briefwechsel, Bd. 1: 450f.)
In einem anderen Fall entschied sich Luise Kulmus für den poetologischen Essay Sieg der Beredsamkeit der populären Schriftstellerin Madeleine-Angélique de Gomez anstatt eines von Gottsched empfohlenen Romans von Madame de Scudéry. In einem Brief vom Dezember 1734 schreibt sie dazu:
Sie nennen mich hartnäckig, daß ich nicht die Geschichte der Thermopylischen Bäder übersetzen will, und Sie thun mir Unrecht. Der Anfang ist schon gemacht, weil es Ihr Wille ist, ich habe nur nicht Lust es zu vollenden. Ich liebe keinen Roman […]. Erlauben Sie mir, den Sieg der Beredsamkeit von der Frau von Gomez zu wählen. Sie lobten dieses Stück in einem Ihrer Briefe, ich las es, und fand einen Trieb in mir, es zu übersetzen. (J.Ch. Gottsched, Briefwechsel, Bd. 3: 267)
Nach ihrer Heirat mit J. Ch. Gottsched war Luise Gottsched in mehrere Projekte ihres Ehemannes fest eingebunden. Bei der vierbändigen deutschen Ausgabe von Pierre Bayles Historisch-critische[m] Wörterbuch (1741-1744), einem Grundlagenwerk der Aufklärung, fungierte sie u.a. als Korrekturleserin. In seinem Nachruf lobt Gottsched, seine Ehefrau habe ihm bei diesem Projekt „die wichtigsten Dienste“ erwiesen (J. Ch. Gottsched 1980 [1763], 526). Sie selbst bezeichnete ihre Mitarbeit in einem Brief vom Oktober 1740 wenig begeistert als „den Handlangerdienst so ich beÿ dem Bäÿlischen Dictionaire leisten muß“ (J. Ch. Gottsched, Briefwechsel, Bd. 7: 194).
Es gibt aber auch Übersetzungen, die Luise Gottsched freier gestalten konnte. H. Brown weist auf eine bisher wenig beachtete Adaptation aus dem Jahr 1753 hin: Der kleine Prophet von Böhmischbroda. Der Text, der in der Literatur häufig als eigenständiges Werk betrachtet wird, basiert auf Le petit prophète de Boehmishbrode von Friedrich Melchior Grimm, einer im biblischen Stil verfassten Satire im Kontext der so genannten guerre des bouffons, in der sich Anhänger der französischen und der italienischen Musik gegenüberstanden. Luise Gottsched verlegte den Schauplatz nach Leipzig und den Tenor der Debatte auf eine Generalkritik an der Gattung Oper, ganz im Sinne von J. Ch. Gottscheds Poetik: „In Der kleine Prophet [Luise] Gottsched made fun of the lightweight genre of the Singspiel and formulated a defense of orderly neo-classical drama à la Racine and Voltaire“ (Brown 2012: 188).
Die späteren Übersetzungen von Luise Gottsched enthalten z. T. auch eigene philosophische Ansichten. Hierzu gehört z. B. die 1756 in deutscher Übersetzung erschienene, philosophisch-theologische Abhandlung Des Abtes Terrassons Philosophie, nach ihrem allgemeinen Einflusse, auf alle Gegenstaende des Geistes und der Sitten. K. Goodman beschreibt in ihrer Analyse Luise Gottscheds eigenen, in die Übersetzung integrierten Beitrag wie folgt: „In a brief fifteen pages L. Gottsched expresses herself quite straightforwardly, carefully distinguishing her philosophical differences with the Catholic abbot by quotation marks“ (Goodman 2013: 13). Goodman charaktersiert L. Gottscheds Haltung folgendermaßen: „It would be a mistake to read this text as a personal profession of non-Christian views, or as religious ‘indifference’, atheism or agnosticism. […] It falls in line with the thought of deists, even with that of British neo-Platonists and a belief in ‘philosophy’“ (Goodman 2013: 16).
Auch in einem anderen wichtigen Teilbereich ihrer nichtliterarischen Übersetzungen zeigt sich z. T. eine bemerkenswerte Eigenständigkeit: in ihren Übersetzungen der Londoner moralischen Wochenschriften The Guardian, The Spectator und The Free-Thinker. Während die Übersetzung der beiden erstgenannten Periodika in Kooperation mit J. Ch. Gottsched und dessen Schüler J. J. Schwabe entstand, war der anonym erschienene deutsche Freydenker ein Projekt von Luise Gottsched, wie aus dem Briefwechsel mit dem Berliner Verleger Ambrosius Haude hervorgeht (in: J. Chr. Gottsched, Briefwechsel, Bd. 9: 8). In ihrem Vorwort An das deutsche Frauenzimmer betont die Übersetzerin, dass Frauen besonders anfällig für religiös begründete Vorurteile seien und dass es daher nötig sei, „die Lehren, wie man, auf eine vernünftige Art, frey denken, soll, insonderheit dem schönen Geschlechte anzupreisen“ (ebd.: XV). Aufgrund seines religionskritischen Tenors wurde der deutsche Freydenker allerdings nach dem Erscheinen von acht Nummern durch die Zensur gestoppt (ebd.: XVI).
Ein quantitativ und qualitativ nicht zu unterschätzender Anteil von Luise Gottscheds Übersetzungstätigkeit bezieht sich auf die Übersetzung wissenschaftlicher Texte. Das umfangreichste Übersetzungsprojekt aus diesem Bereich war die Geschichte der königlichen Akademie der Schönen Wissenschaften zu Paris. G. Ball schreibt zu deren Entstehungsgeschichte „L. A. V. Gottsched übersetzt zehn (der elf) Bände. Ihr Mann verfaßt die Vorrede; gewidmet ist die ‚Akademiegeschichte‘ der Kaiserin. Der mit der Zueignung symbolisierten Verbindung zwischen Pariser Akademie und Wiener Hof folgt die tatsächliche Übergabe des ersten Bandes beim Besuch in Wien“ (Ball 2000: 189). Die Übersetzung erscheint bei dem Wiener Buchhändler Kraus. Vorabdrucke waren in J. Ch. Gottscheds Neue[m] Büchersaal erschienen. Der Gottsched-Biograph G. Waniek hatte Luise Gottscheds Beitrag zu dieser Zeitschrift noch mit den folgenden Worten heruntergespielt: „Mit zahlreichen Auszügen aus französischen Büchern und Zeitschriften mußte Frau Gottsched die Spalten ausfüllen“ (Waniek 1897: 506). Eine angemessene Würdigung dieses Teils ihres Schaffens erfährt Luise Gottsched erst über hundert Jahre später durch die Untersuchung von G. Ball (2000: 171ff.).
Den ersten Versuch eines Gesamtüberblicks über Luise Gottscheds Übersetzungen wissenschaftlicher Texte bietet H. Brown in ihrer verdienstvollen Studie (Brown 2012: 159ff.). Ein bemerkenswertes Übersetzungsprojekt aus dem Bereich der theoretischen Physik sei hier exemplarisch herausgegriffen, die Sammlung aller Streitschriften, die neulich über das vorgebliche Gesetz der Natur, von der kleinsten Kraft in den Wirkungen der Körper, zwischen dem Hn. Präsidenten von Maupertuis, zu Berlin, Herrn Professor Koenig in Holland u. a. m. gewechselt worden. Dieser 1753 erschienene Sammelband enthält neben Texten von Maupertuis und seines Widersachers Koenig u. a. auch die Übersetzung eines satirischen Textes von Voltaire (Diatribe du docteur Akakia), der in dem Streit darüber, von wem das „Gesetz der kleinsten Wirkung“ stamme, gegen Maupertuis, den Präsidenten der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Stellung bezogen hatte.2Voltaires Diatribe du docteur Akakia ist die einzige Schrift, die während der Regierungszeit Friedrichs II. in Preußen öffentlich vom Henker verbrannt wurde. Zu der Bedeutung dieses Textes und dessen Übersetzung schreibt L. Gottsched in ihrer Vorrede:
In Paris z. B. sind in einem Tag 5000 Stück von der so genannten Diatribe des Doctors Akakia verkaufet worden: und in Leipzig sind in einer Woche 500 Stück davon abgegangen. Soll nun ein ehrlicher deutscher Leser, von einer Schrift, die so begierig gekaufet und gelesen wird, nichts erfahren? (zit. nach Brown 2012: 174)
Übersetzungstheoretische Schriften im engeren Sinn hat Luise Gottsched, über einige Vorreden zu ihren Übersetzungen hinaus, nicht hinterlassen. Viele ihrer Übersetzungen können jedoch als praktische Umsetzung des Programms und der Übersetzungstheorie der deutschen Aufklärung (vgl. Poltermann 1987) betrachtet werden. Dies zeigt sich zum einen in der Auswahl der zu übersetzenden Texte, zum anderen in der Übersetzungsmethode. Diese ist häufig einbürgernd, wobei ihre literarischen Übersetzungen und Adaptationen origineller erscheinen als diejenigen ihres Ehemanns. Luise Gottscheds Biografin V. Richel schreibt dazu: „critics generally agree that she was the wittier, more sensitive, and more talented of the two Gottscheds“ (Richel 1973: 7).
Dennoch stand L. Gottsched lange im Schatten von J. Ch. Gottsched: „Bis heute hat man den Eindruck, daß Luise Adelgunde Viktoria Gottsched wie zu Lebzeiten weiterhin im Schatten ihres riesigen Gatten geblieben ist“, schrieb Roland Krebs Anfang der 1990er Jahre (Krebs 1993: 90). Heute wird man dieser Feststellung nicht mehr uneingeschränkt zustimmen können. Luise Gottsched ist inzwischen in den Blickpunkt der feministischen Literatur- und Translationswissenschaft geraten.3Bereits 1986 erschien im Ost-Berliner Verlag Neues Leben (westdeutsche Lizenzausgabe 1989) Renate Feyls Roman-Biographie Idylle mit Professor, die Luise Gottsched als Opfer ihres Ehemanns porträtiert. Dabei betonen die Vertreterinnen der Literaturwissenschaft die Unabhängigkeit und Originalität L. Gottscheds, z.B. in ihren Dramen und Briefen (vgl. Kord 2000). Das Übersetzen als „dienende“ Tätigkeit gerät dabei aus dem Zentrum des Interesses. Komplementär zu dieser Perspektive verhalten sich Arbeiten aus der feministischen Translationswissenschaft, in denen die Übersetzungstätigkeit im gesellschaftlichen Kontext in den Blick genommen wird (z.B. Walter 2001). Eine umfassende und differenzierte Darstellung von Luise Gottscheds übersetzerischem Schaffen bietet die bereits mehrfach zitierte Monographie von Hilary Brown (2012).
Ein Desideratum der Forschung wäre die Eruierung der Autorschaft von Texten, die in Kooperation des Ehepaars Gottsched entstanden und die nicht immer namentlich gezeichnet sind, z. B. bei Beiträgen in den von Gottsched herausgegebenen Zeitschriften (vgl. Ball 2000: 170). Hierzu könnten lexikonstatistische und korpuslinguistische Methoden Hilfestellung leisten. Die Voraussetzung hierfür wäre eine Digitalisierung der entsprechenden Texte. Es ist zu vermuten, dass durch eine solche Untersuchung die Verdienste Luise Gottscheds als bedeutende Übersetzerin und Autorin der deutschen Aufklärung eine noch differenziertere Würdigung erfahren könnten.
Anmerkungen
- 1Die 1968 u. ö. in der Reclam-Universalbibliothek (Bd. 8579) erschienene Ausgabe des Stücks nennt auf dem Titelblatt nur Luise Gottsched als Verfasserin. Im Nachwort von Wolfgang Martens heißt es jedoch: „Die Gottschedin hat ein französisches Stück […] in toto übernommen und nur, freilich sehr geschickt, auf deutsche Verhältnisse eingerichtet. Von einem deutschen ‚Original’ wird man, wenn man den Paralleldruck der Pietisterey mit der Femme Docteur bei A. Vulliod studiert hat, schwerlich sprechen können“ (Martens 1979: 157f.).
- 2Voltaires Diatribe du docteur Akakia ist die einzige Schrift, die während der Regierungszeit Friedrichs II. in Preußen öffentlich vom Henker verbrannt wurde.
- 3Bereits 1986 erschien im Ost-Berliner Verlag Neues Leben (westdeutsche Lizenzausgabe 1989) Renate Feyls Roman-Biographie Idylle mit Professor, die Luise Gottsched als Opfer ihres Ehemanns porträtiert.