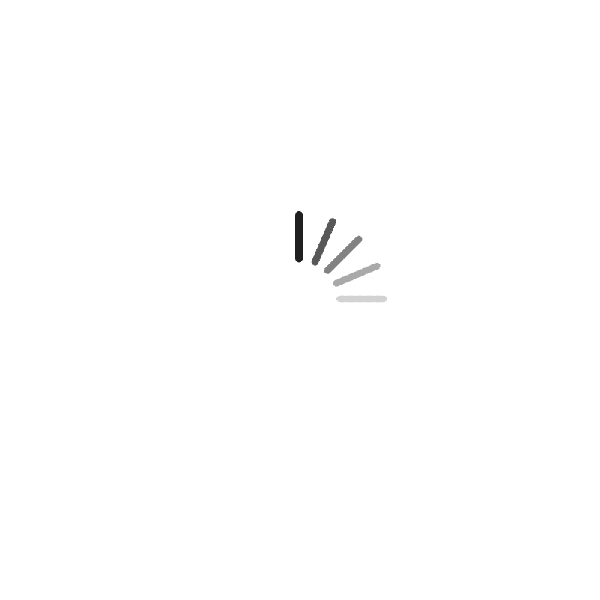Grete Leitgeb, 1903–2020
Obwohl Grete und Josef Leitgeb eines der erfolgreichsten Bücher der deutschen Publikationsgeschichte aus dem Französischen übersetzt haben, ist ihr Name selbst in Fachkreisen wenig bekannt, was zweifellos auch mit dem Umstand zusammenhängt, dass sie die Bühne des Übersetzungsbetriebs nur ganz kurz und eher zufällig betreten haben.
Grete und Josef Leitgeb: Biographischer Kontext
Um zu verstehen, wie das Ehepaar Leitgeb mit dem Übersetzen in Berührung kommen konnte, muss man sich mehrere – sowohl biographische als auch historische – Faktoren vergegenwärtigen.
Josef Leitgeb war, nach dem Wehrdienst (1915–1918) als Kaiserjäger an der Südfront (am Monte Pasubio), in der Zwischenkriegszeit im bürgerlichen Beruf Volksschullehrer (1922–1928), danach Hauptschullehrer (1928–1939). Einen Namen machte er sich in diesem Zeitraum in der österreichischen Literaturszene als Verfasser von Gedichten sowie Romanen. Das 1925 an der Universität Innsbruck abgeschlossene Studium der Rechtswissenschaft betrieb er nicht um einer beruflichen Perspektive willen, sondern – so die naheliegende Vermutung von Ursula Schneider (2024: 223) – um die Zustimmung der standesbewussten Familie von Grete Leitgeb zur Heirat zu erhalten. Während des Zweiten Weltkriegs war er zwei Jahre als Funker in der Ukraine stationiert, ab 1943 leitete er den Militärsender Sistrans bei Innsbruck. Unmittelbar nach Kriegsende wurde ihm die Funktion des Stadtschulinspektors von Innsbruck übertragen; 1946 auch die des Präsidenten der Innsbrucker Volkshochschule. Literarisch profilierte sich Josef Leitgeb in der Nachkriegszeit bis zu seinem frühen Tod weniger als Autor neuer Werke denn als Mitherausgeber der Zeitschrift Wort im Gebirge und, im Rahmen seiner (noch zu erörternden) sprachlichen Kompetenzen, als Übersetzer aus dem Französischen.1Detaillierte Biographie unter Forschungsinstitut Brenner-Archiv, Literatur Landkarte Tirol: https://orawww.uibk.ac.at/apex/uprod/f?p=TLL:2:0::::P2_ID:419.
Seine Ehefrau, geb. Margarethe Ritter, war bis in die unmittelbare Gegenwart in diesem Kontext die große Unbekannte. Johanna Agnes Müller hat in ihrer Diplomarbeit (2005) Informationen gesammelt, die unmittelbar mit der Übersetzungstätigkeit des Ehepaars zusammenhängen. Einige weitere biographische Fakten sind erst dank der jüngst publizierten Recherchen von Ursula Schneider (2024) über sie bekannt. Sie war die Tochter eines prominenten aus Liechtenstein gebürtigen Rechtsanwalts und „absolvierte in der Schweiz das französische Abitur, war vermutlich in einem für das Großbürgertum standesgemäßen Mädchenpensionat in der französischen Schweiz erzogen worden und damit zweisprachig“ (Schneider 2024: 223). Danach studierte sie an der Universität Innsbruck Französisch und Englisch.
So kann man also annehmen, dass im Hause Leitgeb – wie in zahlreichen gebildeten Familien der Zeit – eine tendenziell frankophile Einstellung herrschte. In der gut aufgearbeiteten Geschichte der französischen Besatzungszeit (1945–1955) – Frankreich kontrollierte die westlichen Bundesländer Vorarlberg und Tirol sowie einen Sektor der Bundeshauptstadt Wien – wird durchweg das weitgehend friktionsfreie Klima zwischen der einheimischen Bevölkerung und den französischen Autoritäten betont. Insbesondere wird unterstrichen, dass Frankreich sich als Kulturnation zu präsentieren bemüht war und dabei das demokratische kulturelle Erbe Österreichs als positiven Anknüpfungspunkt hervorhob (cf. z.B. Angerer 2025). Vor diesem Hintergrund ist auch glaubwürdig, was die Autorin eines Standardwerks zum französisch-österreichischen Verhältnis der unmittelbaren Nachkriegszeit über die folgenreiche Begegnung Josef Leitgebs mit dem von der Militärregierung zur Erledigung elementarer kultureller Aufgaben nach Innsbruck beorderten jungen französischen Germanisten, Kulturhistoriker und Architekturfachmann Maurice Besset (1921–2008) lakonisch berichtet: „Kurz nach seiner Ankunft in Innsbruck [am 31. Juli 1945] geriet Besset durch Zufall an den Tiroler Dichter Josef Leitgeb, der ihn bei sich einquartierte“ (Porpaczy 2002: 85). Diese Information ist insofern ergänzungsbedürftig, als das „Verzeichnis der Hauseigentümer“ der bis 1938 selbständigen Gemeinde (und des heutigen Stadtteils von Innsbruck) Mühlau als Besitzerin der von dem Ehepaar bewohnten Villa „Leitgeb Margarethe, Hauptschullehrersgattin“ ausweist (Schneider 2024: 225).
Wenn man diese Informationen miteinander kombiniert, ergibt sich eine plausible Rekonstruktion eines Stücks Übersetzungsgeschichte, auch wenn sich dieses nicht in allen seinen Elementen und Etappen kriminalistisch dokumentieren lässt. Vieles spricht dafür, dass Maurice Besset den entscheidenden Anstoß zum Übersetzen literarischer Texte aus dem Französischen gegeben hat. Mehrfach erscheint sein Name im Tagebuch Josef Leitgebs im Zusammenhang mit übersetzerischen Aktivitäten des Ehepaars. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass der Hinweis auf den ersten Text, den Grete und Josef Leitgeb ins Deutsche gebracht haben, von Besset stammte.
Vor einer eingehenderen Besprechung der Übersetzungen ist jedoch eine Frage zu klären, die lange Zeit weder Verlage noch Literaturwissenschaftler interessiert zu haben scheint: Wie war es um die Französischkenntnisse Josef Leitgebs bestellt? Wie groß kann der Beitrag an den unter seinem Namen publizierten und bis heute lieferbaren Übersetzungen gewesen sein? Denn weder als Absolvent eines humanistischen Gymnasiums noch als Soldat war er mit der französischen Sprache in Berührung gekommen. Mehrere Zeitzeugen – Angehörige, Freunde der Familie, die Schriftstellerkollegin Gertrud Fussenegger (cf. Müller 2005: 15–16), ein mit dem Dichter näher bekannter Germanist (cf. Schneider 2024: 222) – bestätigten, dass Josef Leitgeb des Französischen allenfalls in sehr bescheidenem Maße mächtig war und also wohl nicht die notwendige Kompetenz besaß, um eigenständig literarische Texte aus dieser Sprache zu übersetzen.
Der translatorische Ansatz
Wie also hat man sich die Arbeitsweise von Grete und Josef Leitgeb vorzustellen? Briefstellen und Tagebuchnotizen Josef Leitgebs sowie in gewisser Hinsicht auch das mit handschriftlichen Korrekturen versehene, im nächsten Abschnitt noch ausführlicher zu kommentierende Typoskript der Übersetzung des Petit Prince lassen kohärente Schlüsse zu. Bei den Äußerungen Josef Leitgebs zur Arbeit mit französischen Texten ist auf eine terminologische Unterscheidung zu achten, die von ihm konsequent durchgehalten wird. Demnach bestand seinem Verständnis nach die Aufgabe Gretes darin, Texte zu übersetzen, wogegen er selbst diese danach übertrug. Das ist so zu interpretieren, dass Grete eine philologisch korrekte Version erstellte, die von ihm im Anschluss literarisch bearbeitet wurde. Diese Differenzierung entsprach in der Nachkriegszeit einem Sprachgebrauch, wie ihn beispielsweise Karl Dedecius, eine der namhaften Autoritäten des damaligen Übersetzungsbetriebs, in einem programmatischen Aufsatz sanktioniert hat: „Übersetzung – zuverlässig, aber unkünstlerisch; Übertragung – künstlerisch und zuverlässig; Nachdichtung – künstlerisch, aber unzuverlässig“ (Dedecius 1963: 469). Ein Tagebucheintrag (zitiert nach Müller 2005: 16) vom 18.07.1948 lautet etwa: „Ich habe ‚Le petit prince‘ von Saint-Exupéry, das Gretl ins Deutsche übersetzt hat, auch übertragen“.
Der Umstand, dass aus den Biographien des Ehepaars bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs keinerlei Indizien einer Affinität zum literarischen Übersetzen bekannt sind, legt die Frage nahe, ob die Begegnung mit einem französischen Kulturfunktionär allein den Ausschlag gegeben haben kann, sich dieser Tätigkeit zu widmen. Johanna Agnes Müller hat die Hypothese aufgestellt, dass die Beschäftigung mit Übersetzungen Josef Leitgeb geholfen haben könnte, Phasen einer Schaffenskrise zu kompensieren beziehungsweise zu überwinden (Müller 2005: 14).
Das übersetzerische Œuvre
Die erste Aufgabe, der sich Grete und Josef Leitgeb als Übersetzer stellten, war Antoine de Saint-Exupérys Lettre à un otage. Es ist dies ein 1941 von seinem Exil in den Vereinigten Staaten aus an seinen Freund (und späteren Widmungsträger des Petit Prince) Léon Werth (1878–1955) gerichteter fiktiver Brief, der sich allerdings stellenweise nicht an seinen eigentlichen Adressaten, sondern an das Lesepublikum richtet. So heißt es in einer Passage in der Übersetzung:
Der diese Nacht meine Gedanken heimsucht, ist fünfzig [sic] Jahre alt. Er ist krank. Und er ist Jude. Wie wird er den deutschen Terror überstehen? Um mir vorzustellen, dass er noch lebt, bedarf es des Glaubens, dass ihn der Eindringling hinter dem schönen Wall des Schweigens übersehen hat, mit dem ihn die Bauern seines Dorfes schützten. Nur dann glaube ich, dass er noch lebt. (Zit. nach der Ausgabe Saint-Exupéry 2010: 27).
Die Übersetzung dieses Texts mag sich als eine Art kultureller Versöhnungs- und Wiedergutmachungsarbeit verstanden haben, wobei allerdings daran zu erinnern ist, dass Österreich ab dem Ende des Kriegs nach innen und vor allem nach außen erfolgreich das Narrativ vom ersten Opfer der aggressiven nationalsozialistischen Expansionspolitik gepflegt hat. Der Text wurde vor seiner Freigabe von Maurice Besset gelesen und kommentiert, wie Josef Leitgebs Tagebuch im Eintrag vom 14.05.1946 dokumentiert: „Er [= Besset] findet unsere Übersetzung des Saint-Exupéry sehr gut, geht auf einige Stellen kritisch ein, so dass [sic] wir jetzt alles in Ordnung bringen können“ (zit. nach Unterweger / Zankl 2010: 327). Nach diesem Arbeitsgang wurde der Text offenbar der überaus rührigen und vielseitigen Innsbrucker Kulturhistorikern Lilly Sauter, bei der die meisten kulturellen Aktivitäten im Tirol der Nachkriegsjahre zusammenliefen, übergeben. Sie publizierte die Übersetzung in der von ihr als Schriftleiterin betreuten, in der kurzen Zeit ihres Bestehens (1946–1948) einflussreichen Kulturzeitschrift Wort und Tat (https://www.onb.ac.at/oe-literaturzeitschriften/Wort_und_Tat/Wort_und_Tat.htm), weshalb sich das Typoskript der Übersetzung wohl auch in ihrem Nachlass befindet (cf. Unterweger / Zankl 2010: 325). Als Buch wurde die Übersetzung 1948 im Verlag Karl Rauch mit dem Titel Brief an einen Ausgelieferten herausgebracht, ab der zweiten Auflage (1952) hieß das Büchlein Bekenntnis einer Freundschaft. Dieser Titel wurde auch von zwei neueren Konkurrenzübersetzungen ganz (Julia Schoch, Berlin: Insel 2016) beziehungsweise ergänzend zum ursprünglichen, dem Original näheren Titel (Lydia Dimitrov, dtv zweisprachig, München 2022) übernommen. In der jüngsten Ausgabe des Rauch Verlags aus dem Jahr 2010 (184.–187. Tausend) ist auf dem Umschlag, nicht aber auf dem Titelblatt, der Untertitel Briefe [!] an einen Ausgelieferten angebracht. Im Klappentext wird als Jahr der ersten deutschen Veröffentlichung das Jahr 1955 angegeben, was auf einen wenig sorgsamen Umgang des Verlags mit der Publikationsgeschichte seiner eigenen Produkte schließen lässt.
Das zweite Übersetzungsprojekt, dem sich Grete und Josef Leitgeb gewidmet haben, war André Gides 1946 bei dem renommierten Pariser Verlag Gallimard erschienene Erzählung Thésée. Man hat bisher keinen Hinweis darauf gefunden, warum sie sich dieser „heiteren, leicht ironischen Reflexion über die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten des Menschen“ (Fink 1993: 299) zugewendet haben, die thematisch wie stilistisch den denkbar größten Kontrast zu Saint-Exupérys Lettre à un otage bildet. Johanna Agnes Müller hat anhand der Tagebücher Josef Leitgebs die Entstehungsgeschichte der deutschen Fassung rekonstruiert. Demnach ist sie um die Jahreswende 1947/48, offenbar nach dem bewährten Verfahren, entstanden. Am 3.1.1948 hat Josef Leitgeb laut Tagebuchaufzeichnungen „‘den ganzen Tag am Theseus gearbeitet‘“ (zit. nach Müller 2005: 161), so dass Grete Leitgeb knapp eine Woche später der – in der Diktion der Zeit als „Frl. Wöss“ apostrophierten – Sekretärin der Innsbrucker Volkshochschule den Text diktieren konnte. Diese Version wurde danach wohl von dem Ehepaar noch einmal durchgesehen, denn am 17.1. erfolgte ein zweites Diktat.
Dieses von Frau Wöss getippte Typoskript ist mit einiger Sicherheit das, was [im Brenner-Archiv der Universität Innsbruck] im Bestand Josef Leitgeb unter der Sig. 024-003-I-82 zu finden ist. Es trägt in Josef Leitgebs Handschrift in schwarzer Tinte Verbesserungen sowie die Verfasserangabe „Ins Deutsche übertragen von / J. Leitgeb“. Mit rotem Buntstift fügte Josef Leitgeb später hinzu: „Gretl u.“. (Schneider 2024: 226)
Obwohl Josef Leitgeb als Schriftsteller ja über Erfahrungen im Publikationsgeschäft verfügte, dürfte er verabsäumt haben, sich um die Übersetzungsrechte zu bemühen. Denn er musste erfahren, dass diese schon an den berühmten Romanisten Ernst Robert Curtius vergeben waren, dessen Übersetzung 1949 in der Deutschen Verlags-Anstalt erschien. Ein diplomatischer Vorstoß von Maurice Besset, die Veröffentlichungsgenehmigung zumindest für Österreich zu retten, scheiterte wohl am mangelnden Willen der Beteiligten, die Angelegenheit im Sinn Josef Leitgebs zu regeln (Details bei Müller 2005: 161–163).
Weder die Übertragung des Briefs an einen Ausgelieferten noch das Theseus-Typoskript wurde allem Anschein nach bisher einer philologischen oder translationswissenschaftlichen Betrachtung unterzogen.
Noch bevor geklärt war, dass die Publikation des Theseus scheitern würde, nahm sich das Ehepaar mit Saint-Exupérys Le Petit Prince ein weiteres Werk vor. Darüber, wie diese Entscheidung getroffen wurde und ob beziehungsweise in welcher Form diesmal die Rechte vorher ausverhandelt wurden, ist nichts bekannt. Die Übersetzung erschien 1950 gleichzeitig im Verlag Karl Rauch und bei Arche in Zürich. Dem Tagebuch von Josef Leitgeb ist zu entnehmen, dass Maurice Besset auch in diesem Fall an dem Unternehmen beteiligt war, denn er hält am 9.8.1948 fest, dass das Besset ausgehändigte Manuskript noch nicht beim Verlag Karl Rauch eingetroffen sei (cf. Schneider 2024: 226); der Postverkehr zwischen den Staaten und den Besatzungszonen war durch die Zensur notorisch stark behindert. Sehr wahrscheinlich gehört Besset aber auch zu den ersten Lesern des noch ungedruckten Texts, wobei Leitgeb im Juli 1948 mit Genugtuung notiert, dass diese seinen Enthusiasmus teilen: „[…] viele Leute scheinen davon entzückt zu sein“ (zit. in Müller 2005: 16).
Die älteste bekannte Version des Kleinen Prinzen, die im Brenner Archiv (Sig. 024-002-I-57) aufbewahrt wird, repräsentiert sehr wahrscheinlich die – von Müller (passim) als „Grobfassung“ bezeichnete – Übersetzung von Grete Leitgeb. Sie wird von Schneider (2024: 218) archivarisch genau beschrieben:
Das Manuskript der Übersetzung ist ein Typoskript (ein blauer Durchschlag) von 55 Blatt, paginiert, gelocht, ohne Titel, ohne Verfasser:innen-Angabe, mit nur wenigen und geringfügigen Korrekturen, die keinen seriösen Hinweis auf eine spezifische Handschrift zulassen. Es befindet sich im (Teil-)Nachlass Josef Leitgebs, der 2001/2002 aus den Händen der Kinder Leitgebs übernommen wurde.
Johanna Agnes Müller hat in ihrer vom damaligen Leiter des Brenner-Archivs Johann Holzner betreuten Diplomarbeit dieses Typoskript mit der ersten Publikationsfassung (und diese mit späteren Auflagen) verglichen. Sie geht von der nachvollziehbaren Annahme aus, dass der Großteil der Änderungen auf die „Übertragung“ von Josef Leitgeb zurückzuführen ist, dass aber auch Vorschläge Bessets eingeflossen sein könnten und dass vor allem das Lektorat des Verlags Eingriffe vorgenommen haben dürfte. Müller hat jede noch so kleine Abweichung zwischen den beiden Texten registriert. Einige wenige Beispiele mögen Art und Umfang der Eingriffe illustrieren.
Müller ist erkennbar bemüht, die Änderungen an der deutschen Erstfassung im Geist der stylistique comparée mit Unterschieden in den Ausdruckspräferenzen des Deutschen im Vergleich zum Französischen oder mit Bemühungen um einen ästhetischen Mehrwert der deutschen Druckversion zu begründen, also die Korrekturen als Verbesserungen zu interpretieren. So hebt sie etwa die in traditionellen Stillehrbüchern lange Zeit verpönten, seit den 1970er Jahren in der Sprachwissenschaft jedoch stark aufgewerteten Abtönungspartikeln, die – sicherlich von Josef Leitgeb – in der Buchausgabe ergänzt wurden, als idiomatischen Gewinn hervor, wobei vor allem die relativ hohe Frequenz von ja auffällt, während sie das denn eher als leicht altertümelnd einstuft. Hier das Original und die beiden deutschen Versionen (Müller 2005: 58f.; Hervorhebung J.A.M.):
J’ai alors dessiné l‘intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d’explications. (I, 10)
Typoskript:
Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, damit es die grossen Leute verstehn. Sie brauchen immer Erklärungen. (I, 1 f.)
Gedruckte Ausgabe 1950:
Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. (I, 8)
Et, sur les indications du petit prince, j’ai dessiné cette planète-là. (V, 24)
Typoskript:
Und so habe ich diesen Planeten nach den Angaben des kleinen Prinzen gezeichnet. (V, 10)
Gedruckte Ausgabe 1950:
Und so habe ich denn diesen Planeten nach den Angaben des kleinen Prinzen gezeichnet. (V, 22)
Ein anderer Aspekt, dem Müller sehr viel Wert beimisst, ist das „poetische Wort“ (cf. Müller 2005: 112–122). Es gibt in der Druckfassung eine Reihe von Stellen, an denen die etwas nüchterne Rohübersetzung um ein erleseneres Wort oder eine elaboriertere Wendung bereichert wurde. Ein gutes Beispiel dafür ist die Szene in Kap. XXIV, wo der Ich-Erzähler den eingeschlafenen kleinen Prinzen auf den Armen trägt (Müller 2005: 119; Hervorhebung W.P.):
J’étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. (XXIV, 78)
Typoskript:
Ich war bewegt. Mir war, als trüge ich ein zerbrechliches Gut. (XXIV, 45)
Gedruckte Ausgabe 1950:
Ich war bewegt. Mir war, als trüge ich ein zerbrechliches Kleinod. (XXIV, 76)
Manchmal sind es aber auch nur ganz minimale Umformulierungen, die die Einprägsamkeit erhöhen. Das lässt sich gut an dem ohne Zweifel bekanntesten Satz des Werks zeigen (Müller 2005: 92; Hervorhebung W.P.):
Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. (XXI, 72)
Typoskript:
„Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen nicht sichtbar.“
(XXI, 41)
Gedruckte Ausgabe 1950:
„Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
(XXI, 72)
Wertende Kommentare
Die Sekundärliteratur zu den Übersetzungen von Grete und Josef Leitgeb ist sehr überschaubar. Die beiden hier schon vielfach zitierten, primär auf den Kleinen Prinzen fokussierten Arbeiten von Müller und Schneider scheinen auf den ersten Blick in ihrem Urteil einander diametral zu widersprechen, argumentieren jedoch nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Denn während Müller den Nachweis zu führen sucht, dass die in Summe sparsamen Interventionen Josef Leitgebs den Text seiner Frau (in Müllers Diktion: die „Grobübersetzung“) um poetische Qualitäten bereichert und idiomatisch geschmeidiger gemacht haben, ist Schneider mit dem Ziel angetreten, die Version von Grete Leitgeb als philologisch untadelige Leistung zu würdigen und den Anteil ihrer Urheberin an der Übersetzung entschieden mehr hervorzuheben, als dies bislang geschehen ist.
Le Petit Prince hat die Übersetzer kaum vor sprachliche Probleme oder vor nennenswerte Verständnisschwierigkeiten gestellt – mit einer Ausnahme. Um das Verb apprivoiser, das Schlüsselwort des Kapitels XXI, hat sich unter Übersetzern eine Diskussion entsponnen. Der kleine Prinz kennt es nicht und fragt den Fuchs, der es ins Spiel bringt, nach seiner Bedeutung: «C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie ‘créer des liens’». (XXI, 68)
Grete Leitgeb übersetzte ausgangstextnah: „Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache“, sagte der Fuchs. Es bedeutet ‚Bindungen schaffen‘“ (XXI, 38). Hier hat sich aber offenbar Josef Leitgeb eingeschaltet, denn in der Druckfassung heißt es: „Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache“, sagte der Fuchs. „Es bedeutet: sich ‚vertraut machen‘“ (XXI, 66).
Die meisten Neuübersetzungen haben sich dieser Lösung nicht angeschlossen. Die vom Anaconda Verlag engagierte Übersetzerin Marion Herbert hat allerdings eine Lanze für die Formulierung der Leitgebschen Übersetzung gebrochen und sie auch an einigen Stellen verwendet, wo bei der Erstübersetzung einfach zähmen steht, und sie hat ihre Entscheidung in einer Glosse ausführlich begründet (Herbert 2016).
Die strengste Kritik an der Übersetzung kommt überraschenderweise vom Patmos-Verlag, der in den Jahren 1995–2007 die Geschäfte des Rauch Verlags führte. Im Zug ihres minutiösen Übersetzungsvergleichs, in den sie auch neuere Ausgaben einbezog, stellte Johanna Agnes Müller fest, dass 1998 eine beachtliche Anzahl an Eingriffen in den Text vorgenommen worden war und bat den Verlag um Aufklärung, da die redaktionelle Bearbeitung nirgends offengelegt war. Es bedurfte mehrfachen Urgierens, um schließlich eine – wenig erhellende – Antwort zu erhalten:
Hintergrund dieser Veränderungen waren zum einen heute zumindest in Deutschland völlig ungebräuchliche, veraltet daherkommende Redewendungen, zum anderen einige Übersetzungsfehler. Wegen des großen Bekanntheitsgrades des Textes wurde allerdings nur sehr zurückhaltend redigiert, obwohl eine umfangreichere Redaktion der Qualität des Textes nach Meinung des Lektorats durchaus gutgetan hätte. Vorrang sollte hier die Textkontinuität haben. Im Jahr 2002 wurde die Übersetzung – dem Wunsch der Schulbuchverlage nachkommend – dann auf neue Rechtschreibung umgestellt. (Dorothee Tillmanns, Brief an Johanna Agnes Müller vom 21.06.2004; zit. in Müller 2005: 165)
Müller konzediert, dass einzelne Eingriffe mit Rücksicht auf eine vorwiegend junge Leserschaft des 21. Jahrhunderts vertretbar erscheinen; so etwa die Streichung des Dativ-e bei Substantiven (dem Kinde > dem Kind) oder die Setzung der Vollform des Infinitivs (gehn > gehen). Die implizite Argumentation, dass das Publikum im gesamten deutschen Sprachraum angesprochen werden soll, mag die Eliminierung der (sehr spärlichen) Austriazismen rechtfertigen, wobei das Lektorat hier auch vereinzelten Fehleinschätzungen zum Opfer gefallen sein dürfte. Es muss aber auch erwähnt werden, dass nicht zu begründende Änderungen vorgenommen wurden. Ein besonders augenfälliges Beispiel findet sich in Kapitel XV, wo sich der kleine Prinz – sowohl bei Saint-Exupéry als auch in der Leitgeb-Übersetzung –nicht nur in Anbetracht seiner Körpergröße, sondern vor allem in Ermangelung einer Sitzgelegenheit (man betrachte die dazugehörige Illustration) – auf den Tisch des Geografen setzt. Der Verlag legte aber wohl Wert auf zivilisiertes Benehmen des Protagonisten und dirigierte ihn an den Tisch. Selbst solche die Text-Bild-Kohärenz offensichtlich unterlaufenden Manipulationen sind bis heute nicht rückgängig gemacht worden.
Als der Ablauf der Schutzfrist vor der Tür stand und sich eine zweistellige Zahl an Neuübersetzungen – zu einem guten Teil aus der Feder namhafter Übersetzer – ankündigte, fühlte sich der inzwischen wieder unabhängige Rauch Verlag veranlasst, in seinem Verlagsprogramm eine zwischen Larmoyanz und Gralshüter-Gestus changierende Aussendung abzudrucken:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit einiger Zeit werden Sie durch mehrere Verlage, die Ihnen unbedingt ihren Kleinen Prinzen aufdrängen wollen, verunsichert. Offiziell dürften die Kollegen das erst ab Januar 2015 tun, bereits seit Monaten laufen allerdings unbehelligt manche kleine und große Prinzen durch die Verlagsvorschauen. Unser Tipp: Setzen Sie auf das Original! Denn von ihm werden die meisten bekannten Sätze aus dem Kleinen Prinzen abgekupfert, wenn nicht direkt abgeschrieben. […] Seit 62 Jahren liest und hört man diese Sätze in unseren Büchern und unseren Audioproduktionen. Auf das Original zu setzen hat einen anderen Vorteil: Der Karl Rauch Verlag kennt die Texte der Werke Antoine de Saint-Exupérys und die Literatur über diesen erstaunlichen Autor und besonders über den Kleinen Prinzen am besten. (Zit. nach Artho 2015: 86)
Die zahlreichen Neuübersetzungen des Kleinen Prinzen in die deutsche Standardsprache sowie – nicht zu vergessen – die diversen Fassungen in diatopischen und diachronen [!] Varietäten – bieten viel Stoff für weitere übersetzungshistorische Studien, die noch geschrieben werden müssen.
Das translatorische Schaffen im Kontext des Literaturbetriebs
Josef Leitgeb war nach dem Zweiten Weltkrieg eine anerkannte Autorität in der Tiroler Kulturszene und galt über die Grenzen des Bundeslandes hinaus als bedeutender Lyriker und Erzähler. 1950 wurde er mit dem Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet. In den Würdigungen seines Schaffens wurden seine Verdienste als Übersetzer zu Lebzeiten und noch geraume Zeit danach bestenfalls am Rande erwähnt, meistens aber völlig übergangen. Den großen Erfolg der Übersetzung des Kleinen Prinzen hat der früh verstorbene Autor nicht mehr erlebt. Grete Leitgeb ist offenbar niemals als Kulturschaffende öffentlich in Erscheinung getreten, weshalb ihr Verdienst auch lange unterhalb der Wahrnehmungsschwelle geblieben ist.
Abgesehen von der im Hause Leitgeb auch personellen Trennung zwischen Übersetzung und Übertragung ist den Tagebüchern oder sonstigen Aufzeichnungen Josef Leitgebs keine implizite oder explizite translationsbezogene Reflexion zu entnehmen.Der Kleine Prinz ist bis heute das robuste finanzielle Standbein des Rauch Verlags; auf dessen Homepage heißt es: „Mit einer Verkaufszahl von bislang über 15 Millionen in allen Ausgaben ist die deutsche Originalübersetzung […] der anhaltende Verkaufsschlager des Verlags“ (https://karl-rauch-verlag.de/verlag/geschichte.html). Knapp die Hälfte davon entfällt laut dem Verlagsleiter Hans-Gerd Koch auf die Taschenbuchausgabe (Redaktion Börsenblatt 2021). Gemessen an dieser bis heute sprudelnden Einnahmequelle war die Entlohnung der Übersetzer beschämend kärglich. Johanna Agnes Müller (2005: 163) hat in einem persönlichen Gespräch mit Eckart Leitgeb, dem Sohn des Ehepaars, Einzelheiten in Erfahrung gebracht. Demnach waren als Honorar vier Raten zu je fünfzig D-Mark vereinbart, wobei allerdings nur ein Teil die Adressaten erreicht habe. Geld hat offenbar die Grenzen der Besatzungs- und Währungszonen noch schwerer überwunden als ein Typoskript. Ungeklärt scheint auch die Rechtslage zu sein, weshalb sich der Verlag wohl befugt sah, mit der Übersetzung nach Gutdünken zu verfahren.
Anmerkungen
- 1Detaillierte Biographie unter Forschungsinstitut Brenner-Archiv, Literatur Landkarte Tirol: https://orawww.uibk.ac.at/apex/uprod/f?p=TLL:2:0::::P2_ID:419.