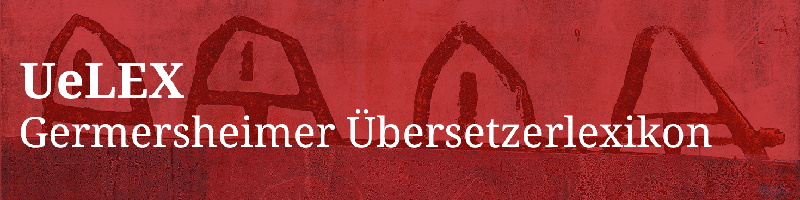Ellen de Boor, 1891–1976
Ellen de Boor, geb. Siebs, verw. von Unwerth, war eine deutsche Übersetzerin aus dem Dänischen, Norwegischen und Schwedischen.
Sie kam am 4. Juli 1891 in Greifswald zur Welt. Ihr Vater Theodor Siebs war von 1890 bis 1902 außerordentlicher Professor für Germanistik, Literaturgeschichte und Volkskunde an der dortigen Universität. Er und seine Ehefrau, die Deutschamerikanerin Ellen Asmus, hatten drei Töchter und zwei Söhne. Die Mädchen gingen nicht zur Schule, sondern wurden „zu Hause teils von Lehrerinnen, teils vom Vater selbst unterrichtet“.1Die Angaben zur Personen- und Familiengeschichte stammen, soweit nicht anders gekennzeichnet, aus Dreschel und dem Familienarchiv Weddigen. Ellen lernte auch Latein und Altgriechisch. 1913 heiratete sie Wolf von Unwerth, der bei Siebs promovierte und bereits als 21-jähriger „ein Auge auf die älteste Tochter seines Professors geworfen hatte, die damals erst 15 Jahre alt war“. Das Paar zog nach Greifswald, er gründete an der Universität das Nordische Seminar und begann, „die nordischen Sprachen minutiös zu kartographieren“. Von Unwerth starb 1919 an der Spanischen Grippe, Ellen blieb mit zwei kleinen Töchtern zurück.
Im Mai 1921 heiratet sie den gleichaltrigen Mediävisten Helmut de Boor. Auch er war ein Schüler von Theodor Siebs, außerdem ein Freund und Mitarbeiter des verstorbenen Wolf von Unwerth. Ellens Tochter Sigrun erwähnt in ihren Lebenserinnerungen, er sei „Pate meiner Schwester und unser geliebter Onkel Helmut“ gewesen und habe „von Jugend an meine Mutter sehr verehrt“. De Boor war von 1919 bis 1922 Lektor in Göteborg, dann Extraordinarius in Greifswald und Leipzig, von 1930 bis 1945 Ordinarius für Germanistik in Bern. Ehefrau Ellen und die Töchter begleiteten ihn auf diesen Stationen.
Auf einer Familien-Internetseite der Familie Unwerth heißt es, Ellen de Boor habe „nacheinander fast alle nordischen Sprachen“ erlernt, ohne dass genauere Zeitangaben gemacht würden. Es bleibt also offen, ob sie mit dem Sprachenlernen schon vor der Ehe mit dem Nordisten von Unwerth und dem Schweden-Aufenthalt mit Helmut de Boor begonnen hat. Sicher ist, dass sie in einem außerordentlich sprachbewussten Milieu aufwuchs und lebte. Das Elternhaus mit einem Mediävistik-Professor und einer deutsch-amerikanischen Mutter vermittelte ihr sicher ein besonderes Bewusstsein für Sprache; ob sie zweisprachig erzogen wurde, ist nicht bekannt. Die Familien Siebs und von Unwerth brachten seit Generationen Professoren der Sprachwissenschaften hervor, Ellens jüngere Schwester Almod heiratete den Germanisten und Professor für slawische Philologie Paul Diels.
Die bereits erwähnte Internetseite erwähnt, Ellen de Boor sei „neben Helmut de Boor zur Übersetzerin und Korrektorin zahlreicher Bücher aus dem nordischen Sprachraum“ geworden. Das erlaubt zwei Interpretationen: Sie wurde es (nur) aufgrund des Lebens an seiner Seite, oder sie wurde, was auch er war. Für ihre Tätigkeit als Korrektorin sind keine Nachweise auffindbar, es ist also ungewiss, ob es Auftragsarbeiten für Verlage oder – beispielsweise – Korrekturen der Texte ihres Ehemannes waren. Der deutsche Wikipedia-Eintrag Ellen de Boor bezeichnet sie als „Autorin“ (Waldkircher 2024), ohne dies zu belegen.
Ellen de Boors erste Übersetzung, Der Juwelenschmuck der Königin des Schweden Carl Jonas Love Almqvist, erschien 1927 bei H. Fikentscher in Leipzig. Der Roman wurde von Klaus-Jürgen Liedtke neu übersetzt, der in seinem Nachwort schreibt:
Die heute verbreitete „frei verdeutschte“ Fassung von Ellen de Boor aus dem Jahr 1927 (in der Reihe Rowohlt Jahrhundert 1989 neu aufgelegt) erweist sich bei genauerem Hinsehen als gefällige Glättung und Kürzung der vielschichtigen Komposition, wobei der Charakter eines Lesedramas verloren geht und die Dialoge teilweise in Prosa verwandelt sind. Almqvists Buch ist weit radikaler, streng und verspielt zugleich. (Liedtke 2005: 415)
De Boors nächste Übersetzung war die Bjørndal-Trilogie des norwegischen Schriftstellers Trygve Gulbranssen (1894–1962), die zwischen 1933 und 1935 in Norwegen und 1935 und 1936 in Deutschland erschien. Wegen dieser – als „berechtigte Übersetzung“ bezeichneten – Übertragung gehört Ellen de Boor zu den wichtigen Norwegisch-Übersetzern und Übersetzerinnen der 1930er bis 1960er Jahre.
Die Trilogie besteht aus den Bänden Og bakom synger skogene (Und hinten singen die Wälder), Det blåser fra Dauingfjell (Es weht vom Totenberg) sowie Ingen vei går utenom (Es führt kein Weg vorbei) und wurde in 30 Sprachen übersetzt. Auf Deutsch erschien sie 1935 und 1936 im Münchner Langen Müller Verlag geringfügig gekürzt in zwei Bänden als Und ewig singen die Wälder und Das Erbe von Björndal.2Das Impressum von Und ewig singen die Wälder nennt als „Titel der norwegischen Originalausgabe“ unrichtig Och bakom synger skogene. Ellen de Boor erhielt den Übersetzungsauftrag offenbar, weil sich, wie Ellens Enkel Erasmus Weddigen schreibt, „beide de Boors der Freundschaft mehrerer nordischer Schriftsteller erfreuten, deren Werke sie übersetzten; so etwa mit Trygve Emanuel Gulbranson [sic]“. Der Kontakt zu Langen Müller lief vermutlich über Helmut de Boor, der dort 1933 seine Übersetzung der Erzählungen des Isländers Gunnar Gunnarsson veröffentlicht hatte. Der Verlag war zudem, so die Historikerin und Literaturwissenschaftlerin Kate Sturge, „traditionally and very successfully specialized in translations with a particular emphasis on Scandinavian languages“ (Sturge 2006: 75). Allerdings konnten übersetzte Romane in Deutschland nur erscheinen, wenn „it’s author was not Jewish, nor was his publisher or translator“ (ebd.).
Gulbranssen war 1936 als Journalist bei den Olympischen Spielen in Berlin. Als Propagandaminister Goebbels bei einem Presseempfang sagte, Hitler habe nur ein Buch auf seinem Nachttisch und das sei Und ewig singen die Wälder, soll der anwesende Gulbranssen den Saal verlassen haben. Er war und blieb ein dezidierter Gegner der Nationalsozialisten (Hoel 2013). Er weigerte sich, in Deutschland Lesereisen zu machen und hielt, anders als der norwegische Literatur-Nobelpreisträger Knut Hamsun, in den fünf Kriegsjahren deutliche Distanz zum deutschen Besatzungsregime.
Helmut de Boor wurde 1936 Mitglied der NSDAP,3Über das Beitrittsdatum gibt es unterschiedliche Angaben. Schoch (2009: 76) kann mit Dokumenten den 16. März 1936 belegen. Ellen de Boor trat im November 1934 der Frauenorganisation der NSDAP NS-Frauenschaft bei, auf dem Antrag fehlt allerdings ihre Unterschrift. Die Reichsschrifttumskammer führte sie nicht als Mitglied, vermutlich, weil sie nicht hauptberuflich übersetzte. Sturge schreibt:
These amateur translators pose an interesting case in that as part-timers they would not have been obliged to join the Reichsschrifttumskammer, thus being freer from political regulation than the full-time translators. Conversely, professional status may have given the full-timers more say with their publishers in the complex process of preparing applications, alterations and finally publication. (Sturge 2004: 88)
Die Gulbranssen-Romane gingen in die deutsche Literaturgeschichte ein, denn „kein anderer ausländischer Autor verkaufte in dieser Zeit [1933–1945] mehr“ (Adam 2013: 242).4Viele Deutsche, die zwischen 1940 und 1945 als Soldaten der deutschen Wehrmacht Norwegen besetzten, hatten Gulbranssens Romane gelesen und erwarteten, dass das Land und seine Bevölkerung diesen Romanen entsprach. Und ewig singen die Wälder war bereits seit 1940 ein Titel der Frontbücherei (vgl. Sturge 2010: 76). Und ewig singen die Wälder hatte nach nur einem Jahr eine Auflage von 181–190 Tsd. erreicht, 1950 war es, so der Sachbuchautor Christian Adam „in Deutschland auf der Liste der 17 erfolgreichsten Bücher des Jahres auf Platz 1 mit einer geschätzten Gesamtauflage von nun über 1 Million Exemplaren“ (ebd.). Sie zählten im „Dritten Reich“ zu den meistverkauften Büchern und bis in die 1960er Jahre hinein zu den meistverkauften Übersetzungen, nicht zuletzt, weil die Romane 1959 und 1960 mit spektakulärem Erfolg verfilmt wurden. Im ersten Jahr, schrieb Der Spiegel, „holte Und ewig singen die Wälder über sieben Millionen Bundesbürger an die Kinokassen“, Gulbranssen könne sich „einer deutschsprachigen Viermillionen-Auflage rühmen“ (Anon. 1960). Die Romane waren in keinem Land so erfolgreich wie in Deutschland. Und ewig singen die Wälder, schreibt Sturge,
seems to have made a reputation and perhaps a modest fortune for its translator Ellen de Boor, whose commissions began to pour in after her Gulbranssen success. (Sturge 2010: 76)
Auch Christian Adam vermutet, dass Ellen de Boor und ihr Mann stark am Erfolg ihrer Übersetzungen partizipierten (vgl. Adam 2013: 134). Ob sie tatsächlich an dem beträchtlichen finanziellen Erfolg beteiligt waren, ließ sich nicht belegen. Eine Anfrage an den Langen-Müller Verlag vom Sommer 2024 mit Bitte um Einsicht in die Verträge mit Ellen de Boor wurde abschlägig beschieden: „Verlagsunterlagen aus der von Ihnen angegebenen Zeit sind nicht vorhanden.“ Neuere Unterlagen müsste es aber geben, denn das Urheberrecht an den Übersetzungen läuft erst 2046 aus.
Gulbranssens Trilogie ist eine Chronik der Familie Bjørndal und ihres Hofes zwischen 1760 und 1830. Die Bücher zählen zum Genre des Heimat-, beziehungsweise Bauernromans, es sind eher unpolitische Unterhaltungsromane als ideologisch aufgeladene Propaganda. Für den Skandinavisten Frithjof Strauß sind sie „dem kleinbürgerlich-eskapistischen röhrenden Hirsch über dem Sofa näher […] als der aggressiven nationalsozialistischen ,Blut und Boden‘-Ideologie, für die sie der zeitgenössische deutsche Markt vereinnahmte“ (Strauß 2006: 248). Auf mein Bitten hat die norwegische Deutsch-Übersetzerin Elisabeth Beanca Halvorsen den Anfang des ersten Bandes im Original gelesen. Sie schreibt:
Die Sprache ist anfangs ungewohnt. Sie ist verdichtet und voller Alliterationen, es gibt Redewendungen und Sprachvarianten, die heute kaum noch benutzt werden. Nach den ersten Seiten aber war es nicht mehr schwierig zu lesen. Der Text fließt schön, die Sprache ist lebendig und kraftvoll, Gulbranssen hat sich offensichtlich stark an der gesprochenen Sprache, genauer gesagt einem bäuerlichen Dialekt orientiert, der unweit der schwedischen Grenze gesprochen wird und in dem es auch hin und wieder schwedische Wörter gibt. Ich selbst kenne das aus dem ländlichen Ostnorwegen, wo ich herkomme, in der Erzählerstimme höre ich erstaunlicherweise meinen Großvater (Jahrgang 1919, Bauer). Der Text wirkt authentisch, volksnah und bodenständig, zugleich hat er sehr poetische Passagen. Stil und Ton des Textes sowie das Naturmystische des Themas erinnern an die norwegischen Volksmärchen von Peter Christian Asbjørnsen und Jørgen Moe. Der Roman schildert eine weit zurückliegende Zeit, das trägt vermutlich zu dem Eindruck von Nationalromantik bei. Vielleicht verbinden deutsche Leser das mit Blut und Boden?
Die Skandinavisten Stefanie von Schnurbein und Bernd Henningsen vertraten die Ansicht, die Romane seien auch darum in Deutschland so erfolgreich gewesen, weil sich de Boor bei ihren Übersetzungen einer Nazi-Terminologie bedient habe. Henningsen findet es
bezeichnend, daß der Titel des Romans von Trygve Gulbranssen dem völkischen Zeitgeist entsprechend übersetzt wurde, damit die Assoziationen stimmen, damit die kraftstrotzenden Bauern, die urwüchsigen Frauen und die rauschenden Wälder in die faschistische Propaganda vom ,nordischen Menschen‘ paßten. Korrekt aus dem Norwegischen übersetzt, müßte der Titel ,Und hinten singen die Wälder‘ lauten – von Metaphysik ist dann nicht mehr viel übrig. (Henningsen 1995: 21)
Vielleicht ging es nur darum, dass Und ewig singen die Wälder entschieden mehr Wucht hat als „Und hinten singen die Wälder“ (das im Übrigen z. B. mit „Und rings(um)“ oder „draußen“ oder „im Hintergrund singen die Wälder“ treffender übersetzt wäre). Kate Sturge merkt an, Übersetzungen skandinavischer Literatur seien häufig der nationalsozialistischen Ideologie „angepasst“ worden, was sich mitunter auf die Wahl des deutschen Titels oder die Umschlaggestaltung beschränkt habe (Sturge 2017). Wir wissen nicht, ob der Titel von Ellen de Boor stammt, vermutlich war das ebenso eine Verlagsentscheidung wie der auffallende Umstand, dass die Übersetzung die Absatzeinteilung des Originals völlig missachtet.
Sturge schreibt über „the lives, working conditions and individual aesthetics“ (Sturge 2004: 77) von Übersetzern und Übersetzerinnen:
Such information is hard to come by, and the context of self- and external censorship by publishers means that translators can only have been one part of a complex of creative and pragmatic decision-making, of which only the results, not the processes themselves, are available to us today. (Ebd.)
Stefanie von Schnurbein merkt an:
An vielen Textstellen wird die Bedeutung von Sippe, Geschlecht und Erbe weiter herausgehoben als im Original. Wo es möglich ist, entscheidet sich die Übersetzerin im Zweifelsfall dafür ,ein recht lapidares ‚folk‘ (also ‚Leute‘) mit ‚Sippe‘ oder ‚Geschlecht‘ zu übertragen. (Schnurbein 2005: 285)
Im zweiten Band denkt der alte Bauer ,på slekten sin – på nye blodsterke liv‘, wörtlich: ,an sein Geschlecht – an neue, blutstarke Leben‘. Die deutsche Übersetzung überführe dies „in eine eugenisch-nationalsozialistische Terminologie, die dem Original fremd ist. In Das Erbe von Björndal denkt Dag nämlich „an seine Sippe – an neues, erbgesundes Leben“. (Ebd.)
Die Berliner Volks-Zeitung rühmt in einer Rezension am 14. Mai 1935 die schöne, epische Sprache des Romans, die dichterisch, klar und einfach sei (vgl. Hoel 2013). Wie Gulbranssens Norwegisch muss auch das Deutsch der Übersetzung schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts archaisch gewirkt haben, doch der Text liest sich gut und zeigt keine auffallende Nähe zu einem nationalsozialistischen Sprachgebrauch – das erwähnte „erbgesunde Leben“ ausgenommen. So scheint es beispielsweise nachvollziehbar, dass ein Großbauer im 18. und 19. Jahrhundert seine Ahnen und Angehörigen als ‚Sippe‘ oder ‚Geschlecht‘ bezeichnet und nicht als ‚Leute‘. Die Vermutung, Ellen de Boor habe tendenziös übersetzt und somit zur Vereinnahmung der Romane durch den Nationalsozialismus beigetragen, hält einer Überprüfung selbst längerer Passagen nicht stand.
Der erste Absatz des ersten Bandes zeigt vielmehr exemplarisch, dass bei der Übertragung einiges beeindruckend gelungen ist:
Berghamrene over Jomfrudals djup blånet med vikende linjer i høstkveldens kaldrå luft. Bakom var himmelen som luende varme med et drag av blod, der solen sank. På den ytterste hammeren stod en bjønn, mørk som berget, og været ned mot den brede bygd, hvor tåke røik over tjern og bekkefar. (Gulbranssen 1933: 11)
Diese Passage ist stark rhythmisiert, laut gelesen wirken die drei Sätze wie ein dunkles Gedicht, es entsteht ein Sog. Das beruht unter anderem darauf, dass das Norwegische viele kurze, einsilbige Wörter hat, außerdem werden die Wörter meist auf der ersten Silbe betont. Bei der Übersetzung in eine stark flektierende Sprache wie Deutsch stellt sich vor allem das Problem der Kürze.
Ellen de Boor findet einige bemerkenswerte Lösungen. Im ersten Satz fasst sie „blånet med vikende linjer“ – wörtlich: „wurden mit weichenden / sich zurückziehenden Linien blau“ – zu „verblauten“ zusammen. „Kaldrå“, eine leicht verständliche Zusammenfügung aus „kald“ und „rå“ – „kalt-feucht“ – könnte ein Hapaxlegomenon sein, das im Norwegischen nur hier vorkommt, de Boor macht aus „høstkveldens kaldrå luft“ – „die kaltfeuchte Luft des Herbstabends“ – „herbstkühle Abendluft“. Der nächste Satz „Bakom var himmelen som luende varme med et drag av blod, der solen sank“ lautet interlinear übersetzt etwa: „Dahinter war der Himmel wie lodernde / flammende / leuchtende Wärme / Hitze mit einem Hauch von Blut, wo die Sonne unterging / sank.“ Das wird zu „Dahinter flammte der Himmel mit blutrotem Schein“. Dass de Boor zugunsten einer Verknappung auf „wo die Sonne unterging / sank“ verzichtet, ist durchaus eine mutige Entscheidung.
Die schroffen Felsklippen über dem Jungfrautal verblauten in der herbstkühlen Abendluft. Dahinter flammte der Himmel mit blutrotem Schein. Auf der äußersten Klippe stand, dunkel wie der Berg selbst, ein Bär und witterte hinab in das weite Land der Menschen, wo Nebel über Teichen und Bachläufen dampften. (Gulbranssen / de Boor 1935: 5)
Das norwegische „berg“ bedeutet „Fels“. Die Übersetzung als „Berg“ mag wie ein falscher Freund wirken, doch vermutlich sollte nach „Felsklippen“ eine Wiederholung vermieden werden. Wichtiger ist, dass sowohl die Rhythmisierung (wenn auch weniger stark ist als im Original) als auch die nachdrücklich beunruhigende Stimmung des Romananfangs erhalten bleiben.
Trygve Gulbranssen hat keine weiteren Bücher geschrieben. 1952 erschien eine Passage, die aus der deutschen Ausgabe von 1934 herausgekürzt worden war, in der Nymphenburger Verlagshandlung unter dem Titel Heimkehr nach Björndal. Übersetzt wurde das 42 Seiten-Bändchen von der Berufsübersetzerin Sophie Angermann. Warum sie und nicht Ellen de Boor den Auftrag bekam, ist nicht bekannt.
Nach den Gulbranssen-Romanen übersetzte Ellen de Boor drei Romane der Norwegerin Barbra Ring, die 1940, 1946 und 1949 erschienen. Zwei weitere Ring-Romane erschienen 1939 und 1948 in der Übersetzung von Helmut de Boor, was die Frage nahelegt, ob und wie sich das Paar ,seine‘ Autorinnen und Autoren aufteilte. Helmut de Boor hat siebzehn Bücher übersetzt, darunter elf Romane des befreundeten Isländers Gunnar Gunnarsson, der meist auf Dänisch schrieb. Für diese Titel nennt der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek nur ihn als Übersetzer. Auf der erwähnten von Unwerth-Seite heißt es aber, Ellen habe „mit Helmut de Boor an […] Gunnar Gunnarsson’s [sic] Einsamer Reiter, Vikivaki oder die goldene Leiter, Im Zeichen Jörds, Der brennende Stein (Islandnovellen), Die goldene Gegenwart und Advent im Hochgebirge“ gearbeitet.
Auch ein Briefwechsel zwischen Ellen de Boor und dem Insel-Verlag legt nahe, dass das Paar gemeinsam übersetzte: 1953 bot ihr der Verleger Friedrich Michael die Übersetzung von Sally Salminens Prinz Efflam an und fragte, „wann Du, bzw. Ihr das übersetzen könnt“ und an welches Honorar sie dächten. Der Roman erschien 1954 als von ihr übersetzt. Als er schlechte Kritiken bekam, schrieb sie an Michael: „Wir haben es ja nicht geschrieben, sondern übersetzt, wie sie es haben will. Natürlich hat auch Helmut versucht, das beste daraus zu machen.“ 1957 wollte sie das Angebot, Geschichten des Dänen Villy Sörensen zusammenzustellen und zu übersetzen, „mit Helmut besprechen“. Tiger in der Küche und andere ungefährliche Geschichten erschien 1959, als Übersetzerin ist nur sie genannt. (Insel Verlagsarchiv DLA)
Der DNB-Katalog führt Ellen de Boor als Alleinübersetzerin von zwölf Titeln. Der letzte von Ellen de Boor übersetzte Titel im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek ist der auf Dänisch verfasste Roman Die gute Hoffnung des färöischen Autors William Heinesen, der 1967 im DDR-Verlag Volk und Welt erschien. Heinesen war zuvor von Alfred Otto Schwede übersetzt worden.
Im Dezember 1945 wies die Schweizer Regierung Helmut de Boor wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus aus. Bei den Anhörungen, die der Ausweisung voran gingen, begründete er den Beitritt zur NSDAP unter anderem damit, dass „die Großmutter meiner Ehefrau reine Jüdin [war], und ich befürchtete Schwierigkeiten mit Deutschland. […] die nicht arische Abstammung meiner Ehefrau [wäre] mir zum Verhängnis geworden.“ (Schoch 2009 : 84f.) Diese biographische Information zu Ellen de Boor wird nur an dieser Stelle erwähnt, sie lässt an Kate Sturges Bemerkung denken, dass im „Dritten Reich“ Übersetzungen nur erscheinen konnten, wenn „it’s author was not Jewish, nor was his publisher or translator.“
Helmut de Boor musste die Schweiz im Januar 1946 verlassen. Ellen de Boor hingegen blieb „im familieneignen Berner Haus“, warum sie ihm nicht folgte, ist unbekannt. 1948 wurde Helmut de Boor bei dem Versuch, die Grenze illegal zu übertreten, verhaftet. Ellen de Boor stellte ein Gesuch, ihren Mann wegen seiner bedenklichen körperlichen Verfassung für drei Monate bei sich behalten zu dürfen, was abgelehnt wurde. Er war von 1949 bis 1959 Ordinarius für deutsche Philologie an der Freien Universität Berlin. Über Ellens Nachkriegsjahrzehnte in der Schweiz wissen wir nahezu nichts, aber sie reiste oft nach Deutschland und auch nach Berlin. Das Paar ließ sich vermutlich nicht scheiden, beide starben 1976, er in Berlin, sie in Luzern.
Ellen de Boors übersetzerisches Gesamtwerk ist schmal, die biographischen Zeugnisse ihres Lebens spärlich, ihr übersetzerischer Nachlass ist nicht erhalten. Wie bei so vielen Übersetzern und Übersetzerinnen wissen wir nicht, warum sie übersetzte, wie sie an ihre Aufträge kam, unter welchen Umständen sie arbeitete, wie hoch ihre Honorare waren, wie sie ihre translatorischen Entscheidungen traf. Ihr Enkelsohn Erasmus Weddigen sagte im Januar 2025 bei einem Gespräch, bedauerlicherweise lebe in seiner Familie niemand mehr, der diese Fragen beantworten könne. Die Familienseite Die Weddigens, Zweig von Unwerth schildert sie als resolutes Haupt der Familie:
Ellen […] war eine energische, sparsame, aber äusserst familienbewusste und deshalb besucher- und besuchsfreudige Person, die ihr ‚Schlösschen‘ am Asterweg in Bern mit eiserner Geschäftigkeit regierte und selten einen Moment ohne Gäste aus den Diels-, Klett-, Weddigen-, Dreschel- oder de Boor-Clans verbrachte. Ihr unerbittliches Korrektorenauge erspähte den geringsten Setzfehler in der Berner Tageszeitung oder den ihr jeweils greifbaren Büchern, um ihn im Anhang zu annotieren.
Auf den ersten Blick wirkt Ellen de Boor wie die sprichwörtliche Professorengattin, für die das Übersetzen von Literatur weniger Beruf als gesellschaftlich akzeptierter Zeitvertreib war. Ein zweiter Blick auf ihre Biografie erlaubt zumindest Zweifel an dieser Deutung. Möglicherweise war sie eine intelligente, sprachbegabte Frau, der von den Konventionen ihrer Zeit zu enge Grenzen gesetzt wurden.
Anmerkungen
- 1Die Angaben zur Personen- und Familiengeschichte stammen, soweit nicht anders gekennzeichnet, aus Dreschel und dem Familienarchiv Weddigen.
- 2Das Impressum von Und ewig singen die Wälder nennt als „Titel der norwegischen Originalausgabe“ unrichtig Och bakom synger skogene.
- 3Über das Beitrittsdatum gibt es unterschiedliche Angaben. Schoch (2009: 76) kann mit Dokumenten den 16. März 1936 belegen.
- 4Viele Deutsche, die zwischen 1940 und 1945 als Soldaten der deutschen Wehrmacht Norwegen besetzten, hatten Gulbranssens Romane gelesen und erwarteten, dass das Land und seine Bevölkerung diesen Romanen entsprach. Und ewig singen die Wälder war bereits seit 1940 ein Titel der Frontbücherei (vgl. Sturge 2010: 76).