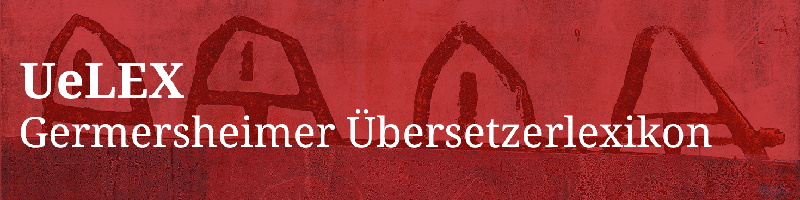Reinhild Böhnke, Jg. 1944
Reinhild Böhnke wurde am 25. Dezember 1944 als Christiane Reinhild Krauspe in Bautzen geboren, ihre Eltern waren der Pfarrer Hans Krauspe und seine Ehefau Irmingard Krauspe, geb. Seidel. Der Vater war ab 1954 Pfarrer an der Leipziger Thomaskirche.
Böhnke wuchs in einem „typischen Pfarrhaus lutherischer Prägung mit pietistischem Einschlag“ auf.1Die nicht näher gekennzeichneten Zitate bzw. Angaben zur Biographie stammen aus Gesprächen, die ich am 6. Februar und 27. März 2025 in Leipzig mit Reinhild Böhnke führen konnte. Die Geschwister, sie hat eine Schwester und zwei Brüder, bekamen neben einer intensiven musikalischen Ausbildung auch Privatunterricht in Englisch; in den Schulen der DDR war bis zur 8. Klasse Russisch die einzige Fremdsprache, nur im neusprachlichen Zweig der Erweiterten Oberschule wurde zu jener Zeit auch Englisch unterrichtet. Böhnke und ihre Geschwister gehörten „weder den Jungen Pionieren noch der Freien Deutschen Jugend an“, weil ihre Eltern und auch sie sich „der religionsfeindlichen Doktrin der DDR nicht unterordnen“ wollten. Wegen dieser oppositionellen Haltung musste sie sich jeden Ausbildungsschritt erkämpfen, alles, vom Wechsel aufs Gymnasium bis zur Promotion, wurde zunächst aus politischen Gründen abgelehnt. Da Böhnke mit Literatur arbeiten wollte, studierte sie in Leipzig Germanistik und Anglistik, was nur als Lehramtsstudium möglich war. 1972 promovierte sie, aber sie blieb unerwünscht; ihre Bewerbungen „u.a. an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften, am Herder-Institut, an der Leipziger Universität, bei Verlagen“ blieben erfolglos.
1967 heiratete sie Gunter Böhnke, Kabarettist, Anglist und ebenfalls Englisch-Übersetzer, 1969 und 1971 kamen ihre beiden Söhne zur Welt.
Sie unterrichtete zunächst freiberuflich Englisch, 1971 übernahm sie zusammen mit ihrem Mann ihre erste Übersetzung, Barry Hines A Kestrel for a Knave für Volk & Welt, dem DDR-Verlag für ausländische Gegenwartsliteratur. Sie begann zu übersetzen, weil ihr nahezu alle anderen Berufswege versperrt waren, aber es gefiel ihr: „Das literarische Übersetzen befriedigte mein Interesse für Literatur und erschien mir als eine Möglichkeit, meine freiberuflichen Tätigkeiten zu erweitern.“
Die Reisebeschränkungen stellten Studierende sowie Übersetzer und Übersetzerinnen aus den – so der offizielle DDR-Begriff – Sprachen des nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiets vor das offensichtliche Problem, dass sie ihre Sprachkenntnisse vorwiegend durch Lektüre erwerben mussten. Das Ehepaar Böhnke suchte Kontakt zu Studierenden aus Großbritannien, die für einige Monate an der Leipziger Universität zu Gast waren, bei landeskundlichen Fragen, die in den Übersetzungen auftauchten, erhielten sie Unterstützung von Dozentinnen und Dozenten der Leipziger Universität. Um ein Arbeitszimmer bekommen zu können und die Genehmigung für eine Reise nach Großbritannien zu erhalten, beantragte sie 1982 die Mitgliedschaft im Schriftstellerverband der DDR, Bürgen waren ein Kollege und eine Kollegin. Aufgenommen wurde sie erst 1987, da „die meist promovierten und nicht in der SED verankerten Übersetzer und Übersetzerinnen verdächtig und eigentlich unerwünscht waren“. 1985, Reinhild Böhnke war vierzig Jahre alt und übersetzte seit fünfzehn Jahren aus dem Englischen, durfte sie zum ersten Mal in ein englischsprachiges Land reisen. Befürwortet wurde das von den Verlagen Reclam Leipzig und Enzyklopädie (für den sie ein Taschenwörterbuch Deutsch-Englisch herausgab) sowie dem Leipziger Schriftstellerverband. Böhnke schreibt:
Die Reise traten wir fast ohne Devisen an (nur die Fahrkarten konnten wir in DDR-Währung bezahlen). Eine kleine Summe meines durch Übersetzungen verdienten Westgelds durfte ich mitnehmen (musste vom Kulturministerium genehmigt werden), sonst bekam man dafür (nach Abzug von Gebühren) nur ‚Forumschecks‘ zum Einkauf im Intershop der DDR. Ohne die Unterstützung britischer Freundinnen und Freunde hätten wir das nicht machen können. (Mail an die Autorin, Mai 2025)
Ihr Mann, so Böhnke weiter, war
durch seine Lektorentätigkeit im Verlag Edition (der hauptsächlich für den ausländischen Markt produzierte) schon auf Dienstreisen im ‚kapitalistischen Ausland‘ gewesen, da der kleine Verlag nicht genug sprachkundige Genossen hatte. Er bekam also sein Visum früher als ich. (Ebd.)
Nach der Wende bereisten sie und ihr Mann nach und nach einige der Länder, deren Literaturen sie übersetzt hatten, neben Großbritannien auch Irland, Kanada, die USA, Australien, Neuseeland, Südafrika und Indien. Doch die Diskrepanz zwischen dem passiven und dem aktiven Sprachwissen blieb, wie Reinhild Böhnke bedauernd sagt, selbstverständlich sehr groß.
In der DDR arbeitete sie hauptsächlich für den Berliner Verlag Volk & Welt sowie für Reclam Leipzig. Es sei damals „relativ leicht“ gewesen, durch eine Probeübersetzung Aufträge von einem Verlag zu bekommen. Sie übersetzte neben Sachbüchern vor allem Prosa, sowohl ältere Literatur wie D. H. Lawrence, Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, H. G. Wells, Henry James, John Galsworthy und Mark Twain als auch Autoren der Gegenwart wie Margaret Lawrence, John Cheever, Anita Desai und Peter Carey. Anfangs gehörten auch Theaterstücke dazu (u. a. von Barry Hines, Athol Fugard und Brian Friel), sie hörte aber damit auf, weil die Bühnenrechte nicht bei Volk & Welt lagen und ihre Übersetzungen nicht aufgeführt wurden.
Bei den Gutachten, die sie für Verlage schrieb, erlebte sie oft, dass ihre Vorschläge aus politischen Gründen nicht angenommen wurden. Bei den fertigen Übersetzungen hingegen erlebte sie offenbar nie Zensur; in einem Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Ferguson über die Übersetzung des Atwood-Romans Surfacing sagte sie:
At the publishing houses for which I worked no one ever prescribed the content of the translation … I was never faced with politically motivated preconception about my translations.
Diese Atwood-Übersetzung, die sie 1978 für den Reclam Verlag Leipzig begann, ist von großem translationshistorischem Interesse. Kurz nachdem sie mit der Arbeit begonnen hatte, wollte der westdeutsche Claassen Verlag die Rechte an der Übersetzung erwerben. Wegen der Lizenzgebühren in begehrten Devisen drängte Reclam Böhnke, das Manuskript schnell abzuschließen, und verkaufte diese Fassung an Claassen. Das führte zu der skurrilen Situation, dass ein ost- und ein westdeutscher Lektor gleichzeitig und unabhängig voneinander dieselbe Übersetzung bearbeiteten. Böhnke selbst empfand ihre Übersetzung als unfertig, durfte aber mit dem Claassen-Lektor Arnulf Conradi keinen Kontakt aufnehmen. Surfacing erschien 1979 im Osten als Strömung, im Westen als Der lange Traum. Stefan Ferguson hat einen äußerst aufschlussreichen Vergleich der beiden Fassungen vorgelegt, bei dem er subtile Unterschiede feststellte. So klingen Atwoods Beschreibungen der Amerikaner in der westdeutschen Fassung mitunter weniger aggressiv als im Original. Eine eindeutig ideologische Färbung konnte er allerdings nur darin sehen, dass die ostdeutsche Fassung, anders als die westdeutsche, ein Nachwort hat, in dem „the East German reader‘s perception of the text is guided in such a way as to conform to the norms of the East German culture“.
Ab Herbst 1989 bis zur Volkskammerwahl im März 1990 arbeitete sie fast ausschließlich politisch für das Neue Forum, dann kehrte Reinhild Böhnke zu ihrer Arbeit als Übersetzerin zurück. Doch der anfänglichen Euphorie z. B. darüber, dass bereits im Dezember 1989 die Zensur abgeschafft wurde, folgte der Zusammenbruch der ostdeutschen Verlagslandschaft. Die meisten DDR-Verlage wurden relativ schnell verkauft oder aufgelöst. Binnen weniger Jahre gingen über 90% der Arbeitsplätze in der Verlagsbranche verloren, Berufsnetzwerke, dem die literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer zum Teil seit Jahrzehnten angehörten, existierten nicht mehr. Viele wurden und blieben arbeitslos. Sie selbst, sagte Böhnke, habe wirklich großes Glück gehabt. Für sie sei der Übergang ziemlich reibungslos verlaufen und habe sehr viele Möglichkeiten gebracht. Sie war eine der wenigen Übersetzenden aus der DDR, die sofort nach der Wende Kontakt zum westdeutschen Übersetzerverband VdÜ suchten. Schon im April 1990 besuchte sie auf dessen Einladung ein Seminar für Englisch-Übersetzung aus (damals noch) Ost- und Westdeutschland im Europäischen Übersetzer-Kollegium Straelen. An dieser historischen Begegnung nahmen teil: Aus dem Osten neben Reinhild Böhnke Ana Maria Brock, Peter Kleinhempel, Peter Meier, Reiner Rönsch und Christa Schünke, aus dem Westen Holger Fliessbach, Irmgard Hölscher, Karen Nölle und Eike Schönfeld, die Namen der beiden anderen westdeutschen Teilnehmenden waren nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Karen Nölle erinnert sich, dass
die ostdeutschen Kollegen und Kolleginnen sehr gut waren, was Jane Austens Schachtelsätze anging, während wir Westler punkteten, als es um Douglas Adams, seine wilden Erfindungen und nicht ganz so korrekten Sätze ging. Das waren die beiden Autoren, an denen wir gearbeitet haben, Klaus Birkenhauer hatte sie sicher mit Bedacht gewählt. (Mail an die Autorin, März 2025)
In einem Text mit dem Titel Unser Weg in den Westen, der in der Zeitschrift Übersetzen erschien, blickte Böhnke 1997 auf diese Begegnung zurück. Sie schilderte die existenziellen Umbrüche für die ostdeutschen Übersetzer und Übersetzerinnen, die im Grunde nahezu vollständige Auslöschung eines Berufstandes. Vor allem aber sprach sie über das Gefühl, dass die Kollegen und Kolleginnen im Westen sie, allen Hilfestellungen zum Trotz, nicht als Gleichberechtigte sahen. Das Treffen wurde für Böhnke der Beginn ihres berufspolitischen Engagements:
Ich nahm aus Straelen im Frühjahr 1990 u. a. mit: ein wenig Trotz (so schnell geben wir nicht auf) und die Bereitschaft, zusammen mit den Kollegen aus den alten Bundesländern etwas für unseren Berufsstand zu tun, nicht nur Hilfe entgegenzunehmen.
Auch hatte sie nach der Wende „unbedingt den Wunsch, mich nun endlich auch offiziell einzubringen“, sie habe endlich mitgestalten wollen, was ihr in der DDR aufgrund ihrer oppositionellen Grundhaltung verwehrt gewesen war. Obwohl sie, anders als viele andere, auch nach der Wende weiterhin vom Literaturübersetzen leben konnte, dachte sie nicht nur an ihre eigene Existenzsicherung, sondern sah es von Anfang an als ihre Aufgabe, sich für Kolleginnen und Kollegen einzusetzen.
1992 gründet sie den „Sächsischen Verein zur Förderung literarischer Übersetzung – Die Fähre e. V.“ mit und war von 1993 bis 1998 dessen Vorsitzende. Ab 1994 arbeitete sie mit dem VdÜ-Vorstand zusammen, 1997 bis 2001 gehörte sie ihm als Beisitzende an, ihre Aufgabe war es,
dem Vorstand von den Aktivitäten, aber auch von den Problemen und Schwierigkeiten der Kollegen in Sachsen und Thüringen zu berichten, andererseits die Übersetzer hier über die Vorhaben der Bundessparte zu informieren und ihnen unsere Verbandspolitik nahe zu bringen.
Sie beriet Kollegen und Kolleginnen, organisierte zahlreiche Veranstaltungen, engagierte sich im Literatur-Kuratorium des Freistaates Sachsen sowie im Vorstand des Sächsischen Literaturrats e. V. In dem bereits erwähnten Text von 1997 betonte sie, dass sie sich nach so vielen Jahren „immer noch als Vertreterin meiner Kolleginnen und Kollegen aus den neuen Bundesländern“ empfinde.
Nach der Wende war in der westdeutschen Verlagslandschaft, leider auch in der Übersetzerschaft, oft Abschätziges über die Arbeit der ostdeutschen Kollegen und Kolleginnen zu hören: Es war die Rede von ihrem „plüschigen Ostdeutsch“ sowie davon, dass sie wegen der Reisebeschränkungen nicht-osteuropäische Sprachen gar nicht beherrschen könnten. Zu den Verlagsmenschen mit einem offenen Horizont gehörte die damalige Cheflektorin des westdeutschen S. Fischer Verlags Ursula Köhler, die, wie sie selbst sagte, mit großem Interesse DDR-Übersetzungen las. Sie schätzte deren Qualität und nahm mit einigen Übersetzern bzw. Übersetzerinnen Kontakt auf.
1991 erschien bei S. Fischer eine Erzählung des australischen Nobelpreisträgers Patrick White, die Böhnke für Volk & Welt übersetzt hatte. Sie erfuhr davon erst, als sie das Buch in einer Buchhandlung sah. Man hatte sie vom Verkauf ihrer Übersetzung nicht informiert, ein Honorar erhielt sie erst auf Nachfrage. Doch dieser Ost-West-Transfer erwies sich als Glücksfall, denn er war der Beginn der engen Zusammenarbeit mit dem S. Fischer Verlag. Ursula Köhler schreibt:
Die kleine böse Erzählung A Cheery Soul (Eine Seele von Mensch) von Patrick White war die erste Übersetzung, die mir von Reinhild Böhnke in die Finger kam. Ich war sofort begeistert, zumal ich von einigen anderen Übersetzungen dieses Autors, den ich sehr schätze, wusste, wie schwer es offenbar war, ihn zu übersetzen. Und gerade bei dieser Erzählung mit ihrer listigen Optik und subkutanen Komik kam es darauf an, sehr präzise in der Nuancierung und dennoch äußerst knapp im Ausdruck zu sein. Besonders gefiel mir, wie klug auch das Nicht-Gesagte, nur Gedachte in die Übersetzung mit eingebracht war. Ich bewunderte das Einfühlungsvermögen von Frau Böhnke, mir schien sogar, die Übersetzung hatte ihr Spaß gemacht. Da ich 1991 gerade einen Übersetzer für J. M. Coetzee suchte, gewiss auch ein schwieriger und schwierig zu übersetzender Autor, setzte ich mich mit Frau Böhnke in Verbindung und bot ihr die Übersetzung von seinem Roman The Master of Petersburg an. Ein glücklicher Einfall, denn sie kannte den Autor bereits und schätzte ihn sehr. (Mail an die Autorin, März 2025)
Böhnke musste aus Termingründen absagen, die erste Zusammenarbeit mit S. Fischer war der Roman Across the Bridge (Die Lage der Dinge) der Kanadierin Mavis Gallant. 1998 übersetzte Böhnke mit Boyhood (Der Junge) ihren ersten Coetzee-Roman, dem (bislang) zwölf Romane, zahlreiche Essays, drei Bücher als Gedankenaustausch mit Paul Auster, Arabella Kurtz und Mariana Dimópulos sowie Coetzees Nobelpreisrede von 2003 folgten.
Böhnke war der Kontakt mit den Autoren und Autorinnen immer sehr wichtig, mit einigen pflegt sie jahrelange persönliche Beziehungen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist seit den Anfängen die englischsprachige afrikanische Literatur und Literatur über Afrika, zu nennen wären Autoren und Autorinnen wie Athol Fugard, Patrick Flanery, Nuruddin Farah, Chimamanda Ngozi Adichie, Nana Oforiatta Ayim und selbstverständlich J. M. Coetzee. Mit ihm verbindet sie die Liebe zu Johann Sebastian Bach. Als Coetzee im Jahr 2000 Leipzig besuchte,
habe ich ihn natürlich in die Thomaskirche geführt. Zu der Zeit wurde gerade die Barockorgel eingebaut und war auch überhaupt nichts an Konzert, und man kam auch nur schwer rein. Da habe ich den Pfarrer Wolf noch persönlich gebeten, dass wir da rein konnten, und habe dann organisiert, mein Sohn war Thomaner, dass er mit einigen seiner Thomanerfreunde da eine Bach-Motette am Grab singt, extra für Coetzee.
Neben Übersetzungen hat sie ein Taschenwörterbuch Deutsch-Englisch publiziert, dessen vollständige Überarbeitung der Verlag Enzyklopädie Leipzig Ende der 1970er Jahre bei ihr in Auftrag gab und das „eine wahnsinnige Arbeit gemacht“ hat. Es erschien 1984, erlebte bis zur Wende sechs Auflagen und wurde dann vom Langenscheidt Verlag übernommen. Ende der 1980er Jahre schrieb sie für den Verlag Edition Leipzig eine Kulturgeschichte der unheimlichen Erzählung, deren Veröffentlichung allerdings zunächst der Wende zum Opfer fiel. 2017 erschien sie als Die Lust am Unheimlichen. Ein Streifzug durch Literatur und Kunst im Leipziger Passage-Verlag.
Reinhild Böhnke hat sich mehrfach über das Übersetzen geäußert. Sie betont stets, dass sie dem Ausgangstext Vorrang einräume, ihre entscheidende Richtlinie sei Treue gegen diesen. Dafür musste sie mitunter kämpfen, bei Volk & Welt beispielsweise
herrschte eine Trennung von Lektorat und Redaktion. Die Redakteure verfolgten oft eine verlagsinterne Vorstellung von einem guten Stil, die aus meiner Sicht mit dem Anliegen der Übersetzerin, den ganz persönlichen Stil des Autors/der Autorin nachzuvollziehen, kollidierte, und wogegen ich mich auch erfolgreich wehrte.
Sie sieht sich mit ihren Übersetzungen als kulturelle Mittlerin, legt größten Wert auf die Verständlichkeit von offenen oder verdeckten Anspielungen, das Aufspüren versteckter Zitate, adäquate translatorische Lösungen für Realien usw. Solche Probleme der Vermittlung löse sie durch geringfügige Ergänzungen im Text, mitunter auch durch Anmerkungen am Ende des Buches. Sie tritt als Übersetzerin immer und ausnahmslos hinter ihre Autoren und Autorinnen zurück.
Sie hat sich auch zur Arbeit mit Coetzees Texten geäußert, der Schriftsteller war „für mich die größte Herausforderung als Übersetzerin“. Seine Prosa sei „gleichzeitig unsentimental und hochpoetisch“, habe aber oft einen „ironischer Unterton“. Das Wichtigste war, „seinen besonderen Stil, geprägt von Knappheit und Präzision an der Oberfläche und einer bedeutungsvollen Tiefenstruktur darunter, zu treffen“.
Coetzee, der sich für die Übersetzung seiner Werke interessiert und gut Deutsch spricht, schätzt Böhnkes Übersetzungen so sehr, dass er sie in einem Essay erwähnt:
Im Laufe der Jahre hat meine deutsche Übersetzerin, Reinhild Böhnke, einen deutschen Text nach dem anderen produziert, die in meinen Augen in keiner Hinsicht den von mir verfassten Texten unterlegen sind. Wenn sie und ich die Rollen tauschen würden, wenn ihr deutscher Text unter ihrem Namen als Autorin erscheinen würde und später dann mein englischer Text als eine Übersetzung ihres deutschen, würde unsere List entdeckt werden? Ich bezweifle es. Als ihr Übersetzer würde ich für die Leistungen gelobt, für die Übersetzer gewöhnlich gelobt werden: Treue dem Original gegenüber, Beherrschung der Idiomatik, et cetera. (Coetzee 2026)
Der Schriftsteller und Übersetzer Jan Wilm, der über Coetzee promoviert hat, hat sich eingehend mit den Übersetzungen und Reinhild Böhnkes Arbeit beschäftigt. Er schreibt:
Zum Beispiel habe ich Coetzees vielleicht bekanntesten Roman Disgrace (dt. Schande) mehrfach auf Deutsch und Englisch gelesen und halte Reinhild Böhnkes Übertragung für eine große Übersetzung. Für mich ist das Original der Übersetzung in nichts überlegen. Ich lese den Roman auf Deutsch und meine, er sei in dieser Sprache verfasst worden. Das ist unheimlich und beeindruckend zugleich. Coetzees täuschend einfache, vermeintlich spröde Sprache ist in Böhnkes deutschem Stil gleichermaßen zu entdecken. Damit meine ich nicht, dass diese Sprödigkeit ästhetisch langweilig sei, im Gegenteil: Coetzees und Böhnkes stilistische Zurückgenommenheit erlaubt, dass kleine poetische Momente nur umso deutlicher hervorschimmern. Immer findet Böhnke in ihren Übersetzungen überraschende Komposita oder poetische Wendungen, die noch blühend-lyrischer erscheinen, weil sie in einer vermeintlich wüstenhaften Trockenheit der Sprache existieren. Reinhild Böhnke drängt sich als Übersetzerin niemals in den Vordergrund. Sie dient der Sprache, dem Text Wort für Wort nach einem heute beinahe altmodisch wirkenden Übersetzerideal. Dieses Ideal ist sehr besonders und heute wichtiger denn je. (Mail an die Autorin, März 2025)
Böhnke hat etwa fünfzig Romane, Erzählungsbände, Essaybände und Sachbücher übersetzt, sechs weitere zusammen mit Gunter Böhnke. Hinzu kommen Kurzgeschichten, Essays und Dramen, die in Sammelbänden erschienen sind. 2024 zog sie zum ersten Mal (bei einem anderen Autor und einem anderen Verlag) ihren Namen als Übersetzerin zurück, nachdem ihr Text durch ein Sensitivity Reading auf eine Weise verändert worden war, die sie nicht gutheißen konnte. Die Leipziger Volkszeitung zitiert sie mit den Worten, „es könne nicht sein, dass die Ästhetik eines literarischen Textes einer gesellschaftlichen Anordnung unterliege, die das Literarische ausblende zugunsten einer Politisierung der Sprache im Interesse einer ideologischen Sprachregelung. Es sei denn, es gehöre zum Inhalt, wie sie das etwa bei Bernardine Evaristos Roman Mädchen, Frau etc. empfinde, aus dem Englischen von Tanja Handels.“ Sie habe sich aber, betonte Böhnke, mit dem Verlag im Guten einigen können.
Ihr „übersetzerisches Credo“ lautet:
Das Übersetzen eines literarischen Textes bedeutet für mich, intuitiv die Intention und die Sprache des Autors zu erfassen und auf geheimen Pfaden ins Deutsche zu schmuggeln; danach den so entstandenen Text mit der ganzen Kraft des eigenen kritischen Vermögens zu kontrollieren und zu bearbeiten. Die Intention des Autors ist der Leitstern meines Tuns.
An anderer Stelle sagte sie: „Das literarische Übersetzen – eine dienend-schöpferische Arbeit – war für mich auch stets eine Entdeckungsreise.“
Anmerkungen
- 1Die nicht näher gekennzeichneten Zitate bzw. Angaben zur Biographie stammen aus Gesprächen, die ich am 6. Februar und 27. März 2025 in Leipzig mit Reinhild Böhnke führen konnte.