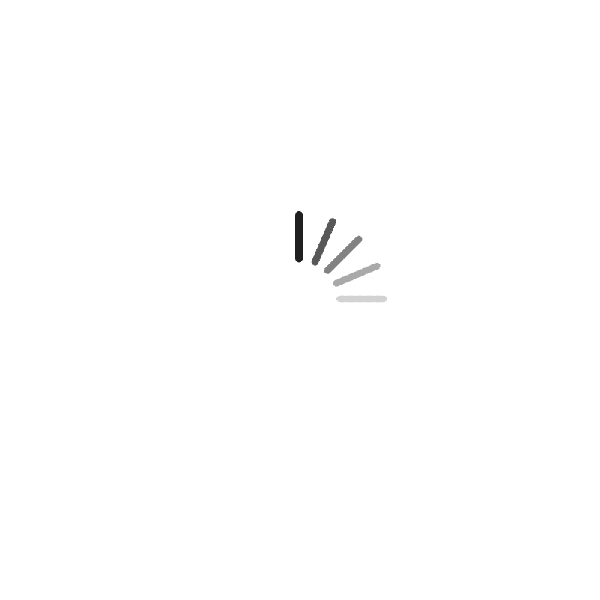Günter Eich, 1907–1972
Günter Eich (geboren am 1. Februar 1907 in Lebus an der Oder, verstorben am 20. Dezember 1972 in Salzburg) zählt zu den bekanntesten und vor allem in den 50er und 60er Jahren nachhaltig rezipierten Dichtern, Hörspielautoren und Übersetzern der Nachkriegszeit. Hörspiele wie Träume (1951) und Gedichte wie Inventur (1945/46) und Latrine (veröffentlicht 1948) gehören bis heute zum nicht zuletzt auch schulischen Allgemeingut. Auch der posthum 1976 erschienene gelbe Suhrkamp-Band mit dem Titel Aus dem Chinesischen, in dem Eichs Anfang der 50er Jahre erschienene Übersetzungen versammelt sind, dürfte seine relativ weite Verbreitung und Bekanntheit dem Ruhm des Dichters verdanken.
Günter Eichs Vater Konrad Otto Eich (1874–1942) stammte aus dem Saarland und heiratete 1902 in Podelzig Emilie Auguste Helene Heine (1880–1918), die aus einer Schmiedemeister-Dynastie kam. Der Vater war Rechnungsführer, Landwirt und zeitweise Gutsverwalter, bis er 1918 nach Berlin übersiedelte und als Buchprüfer und Steuerberater arbeitete. Im gleichen Jahr starb Günter Eichs Mutter.
In dem kurzen Text Ein Lebenslauf (1946/47) schreibt Eich über die Wahl seiner Studienfächer: „Dem väterlichen Wunsch gemäß studierte ich Rechts- und Staatswissenschaften, daneben aus skurriler eigener Neigung orientalische Sprachen“ (Eich 2000: 11, auch in Eich 1973: 464f.; Herv. d. H.P.H.). Wie er zum Chinesischen gekommen ist, hat er Anfang der 30er Jahre in einem Funk-Essay verraten: „Es war eigentlich alles nur ein Zufall und es begann damit, daß ich eines Tages in ein chinesisches Restaurant in Berlin kam und dort versuchte, auf chinesische Weise mit den Eßstäbchen zu essen“ (Storck 1988: 8; Eich 1973: 317f.).
In den Jahren 1925/26 begann er sein Studium der Sinologie in Berlin und ab dem Wintersemester 27/28 zusätzlich das Studium der Volkswirtschaft und Handelsökonomie in Leipzig. 1927 erschienen die ersten Gedichte. 1928/29 hielt sich Günter Eich in Paris auf, weil in Deutschland während dieses Semesters keine Vorlesungen in Sinologie gehalten wurden.1Als ich zu Beginn meines eigenen Sinologie-Studiums Anfang der 80er Jahre Günter Eich unserem damals bereits über 80-jährigen Emeritus Prof. Werner Eichhorn (1899–1990) gegenüber erwähnte, erzählte dieser zu meiner Überraschung einige Details, die sich so bislang in keinem Werk über Eich finden. Beide verbrachten das Wintersemester 1928/29 in Paris, sie teilten dort ein Zimmer und lasen gemeinsam Schriften des daoistischen Philosophen Zhuangzi. Neben einigen Anekdoten erzählte Prof. Eichhorn, nicht nur Eichs Chinesisch sei ausgezeichnet gewesen, sondern auch sein Mandschurisch, und er hätte, wäre er dabei geblieben, eine viel glänzendere sinologische Karriere machen können als er selbst. Eich lebte ab 1932 als freier Schriftsteller, er brach das Studium ab, sein späteres Werk zeugt jedoch von einer lebenslangen Beschäftigung mit China und später mit Japan.
1949 veröffentlicht Eich in der Zeitschrift seines Freundes und Dichterkollegen Peter Huchel (1903–1981) Sinn und Form Übersetzungen von zehn Gedichten des Lyrikers Su Dongpo (Su Tung P’o 1949) und 1952 85 Übersetzungen im von dem Sinologen Wilhelm Gundert betreuten China-Teil der bis heute mehrfach nachgedruckten Anthologie Lyrik des Ostens. Sämtliche Übersetzungen kommen 1976 noch einmal unter dem Titel Aus dem Chinesischen bei Suhrkamp heraus und schließlich finden sich insgesamt 95 Übersetzungen im vierten Band der Gesammelten Werke (Eich 1973: 329–376) – neben drei 1957 entstandenen Nachdichtungen aus dem Ungarischen, bei denen Eich mit deutschen Interlinearversionen der Ausgangstexte gearbeitet hat.
Mit Ausnahme von zwei Gedichten aus der Han-Zeit (2. Jhd. vor bis 2. Jhd. unserer Zeitrechnung) enthält die Auswahl ausschließlich Gedichte aus der Hochzeit der klassischen chinesischen Lyrik, der Tang- (618–907) und der Sung (Song)-Dynastie (960–1127), und hier wiederum mit dem ganz überwiegenden Schwerpunkt auf fünf Namen, die auch im Westen nicht unbekannt sind; aus der Tang-Dynastie: Wang We (Wang Wei)2Schreibung der Namen nach Günter Eich, in Klammern die heute übliche Pinyin-Umschrift. mit sieben, Li Bo (Li Taibai oder Li Bai) mit 22, Du Fu mit 11, Bo Djü-I (Bo Juyi) mit 14 und aus der Sung (Song)-Dynastie: Su Schï (Su Dongpo) mit 21 Gedichten.
Trotz seiner fundierten Kenntnisse des klassischen Chinesisch hat Eich zumeist auf bereits vorhandene englische Übersetzungen sowie auf zwei chinesisch-deutsche Ausgaben von Forke und Woitsch (Forke 1929; Woitsch 1908) zurückgegriffen: 72 der 85 in der Anthologie von 1952 versammelten Gedichte waren bereits in deutscher Übersetzung veröffentlicht. „Von den übrigen 13 waren 12 in englischer Sprache erschienen. Von den zehn Su Dongpo-Übersetzungen lag ein Text ebenfalls schon in einer [1917 erschienenen] Übersetzung von Otto Hauser vor“ (Wei 1989: 11–23).
Auch wenn Wei in seiner Heidelberger Dissertation von 1989 einige Konvergenzen zwischen den bereits bestehenden Übersetzungen und denen Eichs aufzeigt, bescheinigt er den von ihm analysierten Fassungen Eichs dennoch mehr Exaktheit und Präzision (ebd.: 16f.).
Eichs Arbeit mit den chinesischen Texten wurde durch diesen Rückgriff auf schon vorliegende Übersetzungen gewiss erleichtert. Sein wohl auch zeitsparendes Verfahren verwundert weniger, wenn man Eichs Aussage in einem Brief von 1950 bedenkt, dass es sich bei diesen Übersetzungen um einen „Luxus“ handle, den er sich „eigentlich nicht leisten“ könne (Storck 1988: 14). Weis Befund lässt sich auch dahingehend deuten, dass es Eich nicht um sinologische Texterschließung und Kommentierung ging, sondern eben um dichterische Exaktheit und Präzision. Zu seiner Methode sagt Eich selber, dass es „nicht die Aufgabe des Übersetzers [ist], das Original zu verbessern. Übersetzen heißt nicht kommentieren. Wo der Dichter dunkel ist, soll auch die Übersetzung einen entsprechenden Grad von Dunkelheit bewahren“ (ebd.).
Eichs Übersetzungen sind sehr variabel angelegt, zeigen aber auch Regelmäßigkeiten. Es ist immer wieder diskutiert worden, wie man die klassische chinesische Prosodie, die in der Regel aus der gleichen Anzahl Schriftzeichen pro Zeile und, vor allem bei den sogenannten Regelgedichten, aus einer streng vorgegebenen Abfolge der Aussprachetöne besteht, in westlichen Sprachen nachbilden kann. Ein Vorschlag war, die jeweils höchste und komplexeste lyrische Form der Ausgangssprache durch die höchste und komplexeste Form der Zielsprache wiederzugeben – also das chinesische Regelgedicht mit dem westlichen Sonett. Das ist durchaus nicht unüberzeugend, zumal die antithetische Grundstruktur des Sonetts sich auch bei den Regelgedichten findet.
Das löst aber nicht alle Probleme, da es Regelgedichte mit fünf und mit sieben Schriftzeichen pro Zeile gibt. Um auch hier eine Entsprechung zu schaffen, ist man häufig zu der Praxis übergegangen, pro Schriftzeichen einen Versfuß zu setzen, was, zumindest für das Regelgedicht mit fünf Schriftzeichen, erneut für das Sonett mit seinem fünfhebigen Jambus spricht. Problematisch bleibt das Regelgedicht mit sieben Schriftzeichen, da es im Deutschen kein etabliertes siebenhebiges Metrum gibt.
Eich, so zeigt die Analyse seiner Gedichte, hat nie zur Sonettform gegriffen, war aber erkennbar bemüht, pro Schriftzeichen einen Versfuß im Deutschen zu setzen, u. a. bei Nachtgedanken (Eich 1973: 333), Leuchtkäfer (334), Allein auf dem Djing-Ting-Berg (ebd.), Bootfahrt auf dem Dung-Ting-See (ebd.). Dies allerdings nur bei Zeilen mit fünf Schriftzeichen, und auch das nicht durchgehend.
Da im klassischen Chinesischen in der Regel ein Schriftzeichen einem Wort entspricht, die klassische Schriftsprache selbst parataktisch gefügt ist und oft genug auch die Gedichte selbst zu einem parataktischen Stil neigen, kann die semantische Fülle oft nicht mehr innerhalb eines Fünfhebers untergebracht werden. Hier gibt Eich dem Inhalt Vorrang und sucht ihm eine Form, die mehr Platz bereit hält. So wird z. B. aus einem vierzeiligen Einstropher (jueju) ein zweistrophiges Gedicht mit jeweils vier Zeilen, das aber dennoch die Grundstruktur des Originals beibehält, da die vier Reimworte des unterbrochenen Kreuzreims abcb/defe die Viererstruktur des Originals noch anklingen lassen: Im Hirschpark (333), Im Bambuswald (ebd.).
Da das Chinesische aufgrund seiner vielen Homophone eine viel größere Zahl an Reimen bereithält als z. B. das Deutsche, ist oft argumentiert worden, es sei besser, bei Übersetzungen auf Reime zu verzichten. Allerdings hat sich kaum ein bekannterer Übersetzer daran gehalten. Eich behält in den meisten Fällen den Reim bei, verzichtet darauf aber bei Texten, deren Wortmaterial offenkundig keine natürlichen Reimmöglichkeiten zulässt (Nachtgedanken, Blick von der Terrasse; 335). Wo er den Reim beibehält, benutzt er allerdings deutsche Reimschemata. Das aaba des jueju wird wahlweise ersetzt durch einen Kreuzreim abab oder einen unterbrochenen Kreuzreim abcb. Auch jenes Regelgedicht, das bei unterschiedlicher Zeilenlänge immer aus acht Zeilen besteht, transponiert er in deutsche Strophenformen, etwa in zwei Vierzeiler (u. a. Herbstliches Gedenken; 341), kann es aber auch als einstrophiges Gedicht mit acht Zeilen wiedergeben.
Es ist auffällig und durchaus ein Qualitätsmerkmal der Übersetzungen, dass die Reime immer mit vollen Wörtern gebildet werden und sich nie mit Füllseln behelfen, wodurch die Übersetzungen in der Regel zu vollwertigen Texten auf dichterisch hohem Niveau werden.
Der Ton der Übersetzungen ist schlicht, fast nüchtern, es kommt auch bei altertümlichen Formulierungen und Inversionen kaum zu Romantisierungen. Die Diktion ist verkürzend, was an vielen Stellen die parataktische harte Fügung der Originale anklingen lässt: „Zur Hsiang-dji-Klause kannt ich nicht den Weg,/ Weit führt durch Wolkengipfel hin der Steg./ Kein Mensch betritt ihn. Bäume stehn uralt,/ Tief im Gebirg. Doch eine Glocke schallt. […]“ (Buddhistisches Kloster; 331).
Ferner gibt Eich der Verständlichkeit Vorrang vor der Beibehaltung kulturspezifischer Lexik, die durch Anmerkungen erklärt werden müsste. Ein Beispiel: In der letzten Zeile des chinesischen Originals von Buddhistisches Kloster ist die Rede von dem Versunkenen, der Erlösung findet von dem „giftigen Drachen“ – ein buddhistischer Ausdruck für die Versuchungen des Fleisches. In Eichs Version kommt der „giftige Drache“ nicht vor, er übersetzt: „Und der Versunkene Erlösung vom Begehren findet.“ Das ist zu vertreten, da es sich im Original nicht um eine lebendige Metapher oder um ein aus der Situation oder dem Gegenstand abgeleitetes Symbol handelt, sondern um eine rein konventionelle Bezeichnung, deren Bedeutung man einfach gelernt haben muss – ähnlich wie im Deutschen der Fuchs für Schlauheit oder die Schlange für Verschlagenheit steht.
Hie und da kommt es zu Sinnverschiebungen, die vermeidbar gewesen wären. So im Gedicht Allein auf dem Djing-Ting-Berg: „Ein Schwarm von Vögeln, hohen Flugs entschwunden./ Verwaiste Wolke, die gemach entwich./ Wir beide haben keinen Überdruß empfunden,/ Einander anzusehn, der Berg und ich.“ Die letzte Zeile des Originals läuft nicht auf das traute, aber auch (westlich) antagonistische Einverständnis von Mensch und Natur hinaus; dem buddhistischen Menschen verschwindet im Anschauen des Berges, des uralten Symbols der Verbindung von Himmel und Erde, das eigene Ich – etwa: „Vogelschwarm flog hoch und flog dahin,/ Verwaiste Wolke, die voll Muße ging./ Nicht müde wurden wir uns anzusehn,/ Es gab nichts mehr, nur noch den Berg Djing-Ting.“
Nicht überzeugend erscheinen Versuche, etwa die Übersetzung des Gedichts Zu Beginn des Jahres (366) von Su Schï (Su Dongpo) in den Kontext der Suche nach einer neuen Sprache bei Eich und allgemein im Nachkriegsdeutschland zu stellen (Kraushaar 2002). Der Duktus der Übersetzung erinnert zwar tatsächlich stark an die sachliche Nüchternheit eines des berühmtesten Eich-Gedichte: Inventur. Hier wird die Trostlosigkeit des Gefangenenlebens beschrieben, um am Ende im Schreiben Trost zu finden, wo im Chinesischen die Feuer am Fluss abendlichen Trost spenden. Da das Gedicht Inventur aber schon da war, bevor die Übersetzung entstand, müsste man wohl umgekehrt annehmen, dass die neue dichterische Sprache Eichs dort, wo er es für angemessen hielt, auch in seine Übersetzungen Eingang gefunden hat. Zumal die späteren Übersetzungen sich durchaus wieder dem Reim, altertümlicheren Formulierungen und Inversionen zuwenden.
Das Übersetzen gewann für Günter Eich schließlich eine poetologische Bedeutung, die über die Beschäftigung mit konkreten Übersetzungen weit hinausging. Es wurde zu einer Grunderfahrung jeder schriftlichen Fixierung, sei der „Ausgangstext“ nun selbst schriftlich fixiert oder sei der „Ausgangstext“ das, was wir gemeinhin Realität nennen:
Wir bedienen uns des Wortes, des Satzes, der Sprache. Jedes Wort bewahrt einen Abglanz des magischen Zustandes, wo es mit dem gemeinten Gegenstand eins ist, wo es mit der Schöpfung identisch ist. Aus dieser Sprache, dieser nie gehörten und unhörbaren, können wir gleichsam immer nur übersetzen, recht und schlecht und jedenfalls nie vollkommen, auch wo uns die Übersetzung gelungen erscheint. Daß wir die Aufgabe haben zu übersetzen, das ist das eigentlich Entscheidende des Schreibens, es ist zugleich das, was uns das Schreiben erschwert und vielleicht bisweilen unmöglich macht. (Eich 1970: 24; Herv. d. H.P.H.)
Und:
Ich bin Schriftsteller, das ist nicht nur ein Beruf, sondern die Entscheidung, die Welt als Sprache zu sehen. Als die eigentliche Sprache erscheint mir die, in der das Wort und das Ding zusammenfallen. Aus dieser Sprache, die sich rings um uns befindet, zugleich aber nicht vorhanden ist, gilt es zu übersetzen. Wir übersetzen, ohne den Urtext zu haben. Die gelungenste Übersetzung kommt ihm am nächsten und erreicht den höchsten Grad von Wirklichkeit. (Eich 1956: 19; Herv. d. H.P.H.)
Diese Gedanken dürften auch mit der Erfahrung des Übersetzens aus dem Chinesischen zu tun haben, denn vor allem das Übersetzen aus der klassischen chinesischen Schriftsprache legt, aus westlicher Sicht, den Gedanken eines „Lesens ohne Original“ nahe, da hier wie in wenigen anderen Schriftsprachen der Leser auch grammatisch den Text durch sein Verständnis häufig erst konstituieren muss. Sehr überspitzt formuliert könnte man sagen: In westlichen Sprachen kann man über die grammatische Analyse zu einem Verständnis gelangen (v. a. etwa im Lateinischen), im klassischen Chinesischen kommt man in Zweifelsfällen über das Verständnis zur grammatischen Festlegung. In diesem Sinn mag auch Eichs Aussage zu verstehen sein, das Chinesische ziele auf den weisen, die deutsche Sprache auf den wissenschaftlichen Menschen (Eich 1950: 316).
Und so denkt Eich sein übersetzerisches Schreiben und schreibendes Übersetzen als ein Übersetzen ohne Original, ein Frage- und In-Frage-Stellen, ein apophatisches, mithin auch kauzig-komisches Sprechen, das u. a. im ersten Satz des Gedichts Nicht geführte Gespräche (1963/64) direkt zur Sprache kommt: „Wir bescheidenen Übersetzer,/ etwa von Fahrplänen,/ Haarfarbe, Wolkenbildung,/ was sollen wir denen sagen,/ die einverstanden sind/ und die Urtexte lesen?“
Eichs Werk wird seit einiger Zeit auch in China rezipiert. Es finden sich eine Reihe von Artikeln, die sich hauptsächlich mit seinen Hörspielen befassen, vor allem mit dem Stück Träume, in dem einer der Träume in die alte chinesische Gesellschaft zurückführt. 1984 erschien eine Sammlung seiner Hörspiele in chinesischer Sprache, im Netz finden sich 38 Gedichte in der Übersetzung des Dichters Hu Sang.3http://miniyuan.com/simple/?t3206.html (Mai 2015).
In den 1980er Jahren konnte das Deutsche Literaturarchiv Marbach einen wichtigen Teil des Nachlasses von Günter Eich erwerben. 2006 gelang es, weitere Materialien von der Familie zu übernehmen.
Anmerkungen
- 1Als ich zu Beginn meines eigenen Sinologie-Studiums Anfang der 80er Jahre Günter Eich unserem damals bereits über 80-jährigen Emeritus Prof. Werner Eichhorn (1899–1990) gegenüber erwähnte, erzählte dieser zu meiner Überraschung einige Details, die sich so bislang in keinem Werk über Eich finden. Beide verbrachten das Wintersemester 1928/29 in Paris, sie teilten dort ein Zimmer und lasen gemeinsam Schriften des daoistischen Philosophen Zhuangzi. Neben einigen Anekdoten erzählte Prof. Eichhorn, nicht nur Eichs Chinesisch sei ausgezeichnet gewesen, sondern auch sein Mandschurisch, und er hätte, wäre er dabei geblieben, eine viel glänzendere sinologische Karriere machen können als er selbst.
- 2Schreibung der Namen nach Günter Eich, in Klammern die heute übliche Pinyin-Umschrift.
- 3http://miniyuan.com/simple/?t3206.html (Mai 2015).