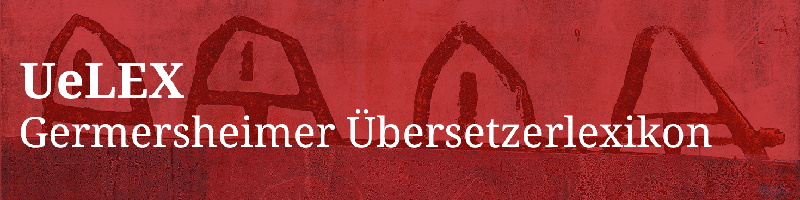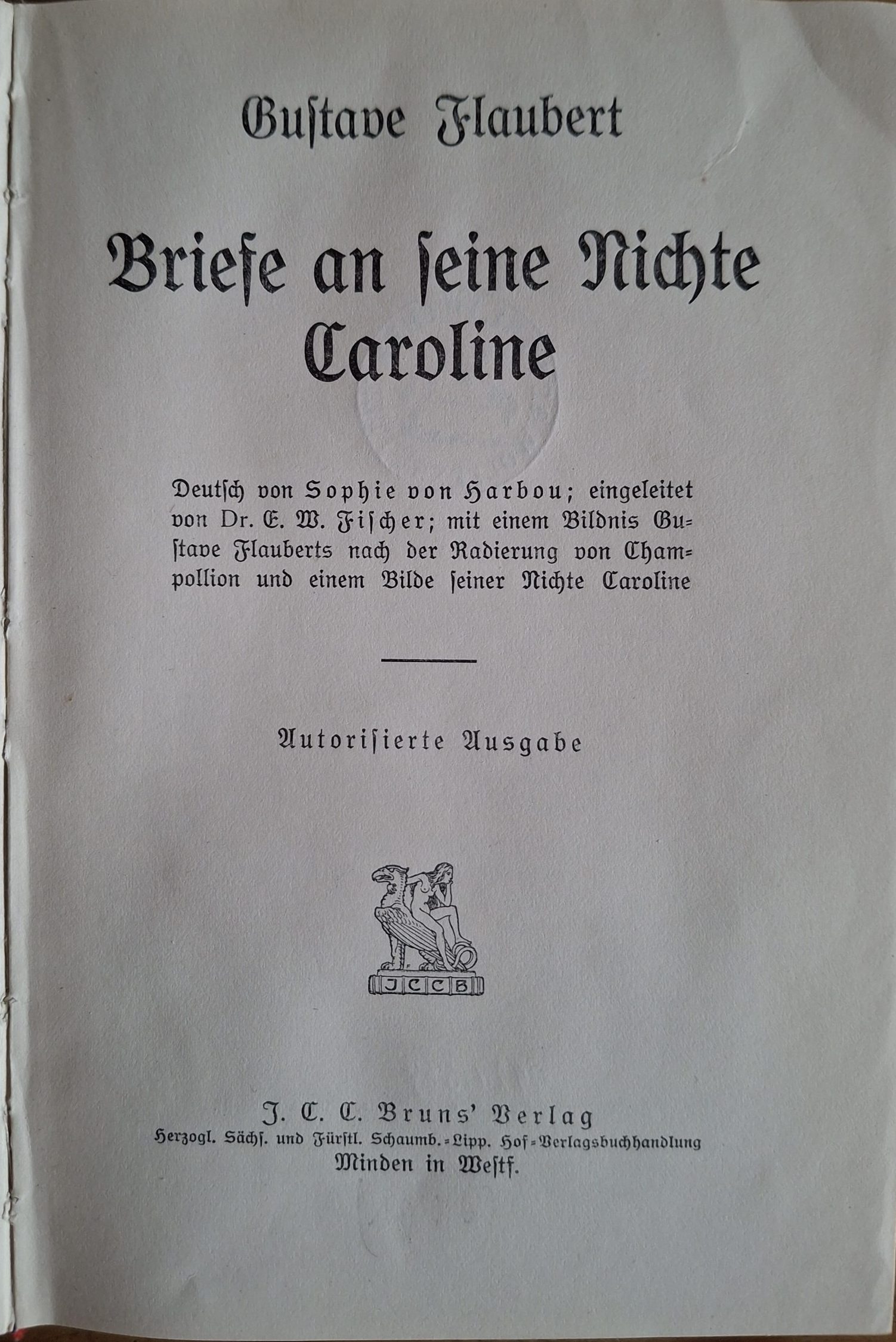Sophie von Harbou, 1865–1940
Biografie
Sophie von Harbou wurde am 15. Oktober 1865 in Rendsburg geboren. Sie besuchte die Mädchenschule des Schriftstellers Johann Hinrich Fehrs (1838–1916) in Itzehoe. Ihren Wunsch zu studieren konnte sie sich nicht erfüllen, da dies Frauen noch nicht erlaubt war. So arbeitete sie als Übersetzerin für Englisch und Französisch sowie zeitweise als Lehrerin in Kiel. Wie und wo sie sich die nötigen Kenntnisse für diese beiden Berufe aneignete, ist nicht bekannt. Auf zahlreichen Auslandsreisen nach Frankreich, Belgien und England erweiterte sie ihre sprachliche und kulturelle Kompetenz.
Mit der Schauspielerin Louise Dumont (1862–1932) wollte sie Anfang des 20. Jahrhunderts eine Reformschule nach dem Vorbild der „Ruskin School Home“ des englischen Sozialisten und Lehrers Harry Bellerby Lowerison (1863–1935) gründen, aber der Plan scheiterte vermutlich wegen fehlender finanzieller Mittel. Sophie von Harbous Lebensmittelpunkt war ihr Haus in Groß-Flintbek bei Voorde, in dem sie auch Zimmer an Erholung suchende Gäste vermietete. Gelegentlich bot sie öffentliche Kurse zum Thema „Grundzüge der Staats- und Bürgerkunde“ an. Sie engagierte sich außerdem in der bürgerlichen Frauenbewegung, gab Informationsbroschüren zum Frauenstimmrecht heraus und hielt Vorträge über deutsche und ausländische Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Von April 1912 bis Juli 1914 war sie die Redakteurin des literarischen Teils der Zeitschrift Die Frauenbewegung und besprach selbst zahlreiche belletristische Werke. Im August 1926 wurde sie Konventualin im St.-Johannis-Kloster vor Schleswig. Sie starb am 5. Dezember 1940.
Übersetzungen
Sophie von Harbou übersetzte über einen Zeitraum von zwanzig Jahren für verschiedene Verlage Werke aus dem Englischen und Französischen ins Deutsche. Dazu zählten Gedichte des britischen Schriftstellers Alfred Tennyson (1809–1892), Essays des amerikanischen Schriftstellers und Philosophen Ralph Waldo Emerson (1803–1882), eine Biografie des Sohnes Edward Waldo Emerson (1844–1930) über seinen Vater, geisteswissenschaftliche Texte des britischen Dichters und Sozialreformers Edward Carpenter (1844–1929) sowie des US-amerikanischen Germanisten Albert Bernhardt Faust (1870–1951), ein Roman des Briten George Meredith (1828–1909), ein Kinderbuch des Schotten Robert Louis Stevenson (1850–1894) sowie Briefe des französischen Schriftstellers Gustave Flaubert (1821–1880).
Nur selten äußerte sie sich über ihre Arbeit. In der Einführung zu Emersons Essays dankte sie dem österreichischen Schriftsteller und Übersetzer Karl Federn (1868–1943) für Anregungen und analysierte wichtige Thesen der beiden Emerson-Biografien, die sie gelesen hatte. Im Vorwort zur Biografie des Sohnes beschrieb sie in sehr persönlichen Worten, wie sie Ralph Waldo Emersons Werke kennen und schätzen lernte. In der Zeitschrift Die Frauenbewegung bewertete in einer Rezension die Leistung der Übersetzerin als kongenial, weil die Illusion entstehe, dass man das Original lese.
Dass sie mit den Autoren in Kontakt stand, lässt sich nur im Falle Edward Carpenters belegen. In seinem Nachlass befinden sich drei Schriftstücke von ihr aus dem Jahr 1912. Die zeitgenössische Kritik in Tageszeitungen und Kulturzeitschriften beurteilte von Harbous Arbeit fast immer positiv – allerdings mit den üblichen allgemeinen Formulierungen. So lobte ihre Kollegin Amelia Kemper von Ende (1856–1932) nicht nur ihre Sprachkompetenz, sondern auch ihr Einfühlungsvermögen in der Vorbemerkung zu Emersons Essays, weil sie das Wesen des Schriftstellers so gut erfasst habe. In einer vergleichenden Analyse von Tennysons Jugendgedichten in deutscher Übersetzung hielt der Münsteraner Lehrer Wilhelm Meyer (1885–?) ihre Arbeit überwiegend für gelungen, attestierte ihr jedoch in einigen Fällen nur Mittelmaß. Warum sie ihre Tätigkeit als Übersetzerin beendete, ist nicht bekannt.