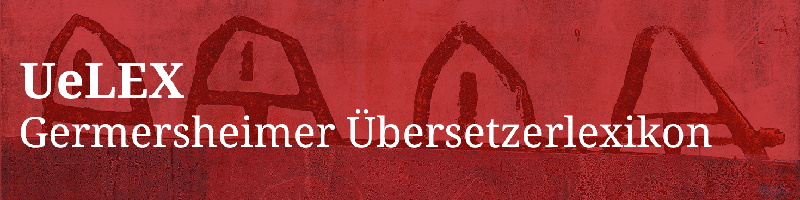Anni Carlsson, 1911–2001
Anni Carlsson wurde als Anni Ruth Rebenwurzel am 1. November 1911 im damals noch eigenständigen Charlottenburg geboren und starb am 20. Februar 2001 in Berlin. Als Tochter eines Bankiers besuchte sie das Fürstin-Bismarck-Realgymnasium im mittlerweile nach Berlin eingemeindeten Charlottenburg. Dort legte sie 1931 ihr Abitur ab und studierte in den Jahren 1931–1937 Philosophie, Deutsche Philologie und Geschichte an den Universitäten Berlin, Köln und Basel. 1937 wurde sie bei Nicolai Hartmann und Herman Schmalenbach mit einer Arbeit über die Philosophie des Novalis promoviert, ihre 232 Seiten umfassende Dissertation Die Fragmente des Novalis wurde 1939 sowohl in Basel als auch in Berlin veröffentlicht.1Die Angaben zu ihrem Studium lt. „Lebenslauf“ in ihrer Dissertation von 1939.
Sie war damals bereits schwedische Staatsangehörige protestantischer Konfession, während ihr jüdischer Vater Siegfried Rebenwurzel sich nach Genf gerettet hatte. Nachdem sie am 1. März 1938 – also kurz vor dem „Anschluss“ – von Österreich aus in Schweden eingereist war, lebte sie für einige wenige Monate bei einem Unternehmerpaar in Munkfors, Värmland. Ende Juni 1938 heiratete Anni Rebenwurzel in Stockholm (pro forma?) den schwedischen Instrumentenbauer Stig Carlsson und lebte seither in Lidingö bei Stockholm. Mit der Heirat erhielt sie umgehend die schwedische Staatsbürgerschaft, ohne je bei der Polizei vorstellig geworden zu sein.2Die Angaben wurden den spärlichen Unterlagen im schwedischen Riksarkivet, Stockholm, entnommen.
In den frühen 1940er Jahren begann sie in Schweizer Zeitschriften (Schweizer Monatshefte; Schweizer Rundschau) zu veröffentlichen, später schrieb sie für die Neue Zürcher Zeitung, Die Zeit und den Berliner Tagesspiegel. Erste übersetzte Bücher erschienen in der Schweiz. 1948, als sie Verner von Heidenstams postume Memoiren für den Schweizer Verlag Huber & Co. übersetzte, lebte sie noch in Stockholm. 1950 zog sie nach Göttingen, später weiter nach Tübingen, 1996 kehrte sie nach Berlin zurück. Die letzten fünf Jahre ihres Lebens verbrachte sie in einer im Krieg durch Bombardements stark zerstörten, neu bebauten Gegend in der Luisenstadt in Berlin-Kreuzberg.3Ihre letzte Adresse war laut Berliner Telefonbuch von 1998/99: Lobeckstr. 48, Berlin-Kreuzberg. Tel. 614 25 52.
Anni Carlsson veröffentlichte als Germanistin Arbeiten zur deutschen und skandinavischen Literatur, zu den deutsch-nordischen Literaturbeziehungen sowie zur Literaturkritik. Sie war ferner Herausgeberin des Briefwechsels zwischen Hermann Hesse und Thomas Mann (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1968, zahlreiche Neuauflagen und Übersetzungen in andere Sprachen).
Obwohl das Übersetzen nie zu ihrer Hauptbeschäftigung wurde, übersetzte Anni Carlsson erstaunlich viele Werke dänischer, norwegischer und schwedischer Autoren ins Deutsche, darunter das Bilderbuch ohne Bilder sowie Märchen von Hans Christian Andersen, die postume Familiengeschichte Als die Kastanien blühten von Verner von Heidenstam, Erzählungen der Nobelpreisträger Eyvind Johnson und Selma Lagerlöf sowie von August Strindberg, Kinder- und Jugendbücher von Maria Gripe und Birgitta Stenberg, außerdem einen Auswahlband mit Gedichten von Karl Vennberg. Und mittendrin 1967 die Memoiren der Königin Christina von Schweden mit einem glänzend geschriebenen, von Carlsson selbst verfassten Nachwort, das allerdings keinerlei Ausführungen zu ihrer Übersetzung enthält.
Eine ihrer frühesten Übersetzungen ist die H. C. Andersen-Monographie des schwedischen Hegelschülers und Kritikerpapstes Fredrik Böök aus dem Jahr 1938. Böök war zu der Zeit auch im Dritten Reich wohlgelitten, seine Notizen von einer Reise durch Deutschland im Jahr 1933 waren auch ins Deutsche übersetzt worden, allerdings nicht von Anni Carlsson.4Zwei Bücher des erzkonservativen, im Verlauf der 1930er Jahre immer frenetischeren NS-Apologeten Fredrik Böök erschienen auch im Deutschen Reich: Hitlers Deutschland von außen (München: Georg Callwey 1934) und Das reiche und das arme Schweden (Berlin: Reimar Hobbing 1938). Die Schrift von 1934 sei von Dr. Friedrich Crusius übersetzt, heißt es in einer „Schlußbemerkung“, und ohne Zusätze und Änderungen veröffentlicht worden, was Tomas Forser in seiner Abhandlung Bööks 30-tal (Stockholm 1976) korrigiert. Jedenfalls argumentiert Böök bereits 1933 vehement für eine Revision des Vertrags von Versailles, sonst sei ein Krieg unvermeidlich. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten sieht er als einen Wendepunkt, „weil Deutschlands Untergang den Untergang eines Europa bedeuten würde, in dem ich mich als Mitbürger gefühlt habe.“ (Böök, Hitlers Deutschland von außen, München 1934,S. 37). Vgl. auch sein Reisebuch Bil till Belgien. En sommarresa 1937. Stockholm 1937.
Anfänglich zeichnet Carlsson als Übersetzerin ein leicht preziöser Stil aus, in Verner von Heidenstams Autobiographie heißt es etwa: „Alles ward mir nun plötzlich gegeben. Das Unfaßliche geschah, daß es mir vergönnt wurde, einige Jahre auf der Erde als Mensch zu leben. Von hohen Kastanien beschattet, stand vor dem einen Fenster ein Kirschbaum. Wiewohl verkrüppelt, trug er Frucht.“ (Heidenstam 1948: 8). Die Erzählung selbst ist, wie es von der Großmutter heißt „ein Überbleibsel vornehmerer Zeitläufte“ (ebd.: 10), der Gutsbesitz, auf dem von Heidenstam aufwächst, ein „in sich abgeschlossenes Reich“ (ebd.: 20).
Carlsson zeichnet in ihrem Nachwort das Porträt des schwedischen Adligen in seiner aristokratischen Geisteshaltung, der aber in den Konventionen seiner Klasse nicht gefangen blieb. Könnte das nicht auch für das übersetzerische Werk der Anni Carlsson gelten? Gefangen im Nazijargon wird für sie ein Reifrock zum „Julklapp“ (ebd.: 15)? Gut hingegen trifft sie das Kolorit des adligen Gutshofs, etwa mit der Bezeichnung „Leutekinder“. In ihrem 1948 in Stockholm verfassten Nachwort zu den Heidenstam-Memoiren zitiert Carlsson die Inschrift seines Sarkophags: „Hier ruht die sterbliche Hülle eines alten Mannes. Dankbar pries er das Unfaßliche, daß es ihm vergönnt war, ein Leben auf der Erde als Mensch zu leben.“ Und sie konstatiert, wie selten heute, im Jahr 1948, ein solches Pathos geworden sei. Heidenstams Persönlichkeit bleibe eben nicht in den Konventionen gefangen, sondern entfalte sich „in einem freien Raume unverkürzten Menschentums“ (ebd.: 193). Heidenstams Pathos entspricht durchaus dem Hang zum Preziösen in der Übersetzung Anni Carlssons.
Vergleicht man mit dem im Heiderhoff Verlag 1986 erschienenen zweisprachigen Gedichtband Ein Gedicht ohne Gesellschaft von Karl Vennberg, einer ihrer letzten Übersetzungen, die sie mit einem Hesse-Motto einleitet,5„Sammle dich und kehre ein, / Lerne schauen, lerne lesen! / Sammle dich – und Welt wird Schein, / Sammle dich – und Schein wird Wesen.“ so spürt man, welch weiten Weg zu einem strafferen, unterkühlten Stil sie in dieser Gedankenlyrik zurückgelegt hat: „Dies ist Dichtung, die niemanden angeht. / Vergeude deine knappe Zeit nicht damit, sie zu lesen. / Tritt ein in eine Guerillabewegung.“ (Vennberg 1986: 7). Es sind zuverlässige Übertragungen dieses Dichters eines ideologischen Nullpunkts nach der Desillusionierung bei Kriegsende, für die sie laut eigener Aussage aus Schweden viel Zustimmung erhalten habe.6Für ihre „poetischen“ Übersetzungen laut Postkarte aus Tübingen an mich vom 17. 9. 1992. So verdienstvoll die Ausgabe und ihre Arbeit als Herausgeberin ist, ist die Häufung an Genetiv-Metaphern der Wirkung heute ein wenig abträglich. Eine Textstelle, die einen Kritiker ins Grübeln bringen kann, lautet: „Ich könnte ein Insekt sein, das sein Fangnetz spinnt […], und suche ein Schicksal, in das ich mich einfühle.“ So übersetzt Carlsson an Stelle von: „ein Schicksal, in das ich mich füge“ (37), und eine „isoleringscell“ wird ihr etwas umständlich zur „Einzelhaftzelle“.
Als weiteres Übersetzungsbeispiel sei eine Erzählung von Eyvind Johnson aus dem schwedischen Norrland angeführt, Uppehåll i myrlandet, der schwedische Titel wurde mit Aufenthalt im Sumpfgebiet wiedergegeben, was die Leserassoziationen in eine falsche Richtung lenkt, da es um die Erzbahnen geht, die wegen des Gegenverkehrs einen Halt einlegen müssen. Eine Übersetzung mit „Halt im Moor“ wäre mindestens ebenso gut denkbar. Aus dieser Erzählung sei ein Absatz in voller Länge zitiert:
Als der schwere Erzzug an diesem heißen Vorkriegstag auf dem Nebengleis stand, kletterte der Führer kurz vor Ankunft des Gegenzuges von der Lokomotive herunter und ging schnaufend über die Schienen.zum Bahnhofsvorsteher. Die Bremser blieben auf ihren Plätzen, zum Teil ohne Mütze, mit aufgeknöpften Jacken und Hemden, und rauchten Armirozigaretten aus Holzspitzen. Im Kies hinter dem Bahnhof lief ein Huhn dreimal um die Regentonne. Im Hauptgraben quer durch den großen Sumpf trocknete das Wasser langsam ein oder versauerte in farbenschimmernden Pfützen. Der Heizer kletterte mit einer langen Ölspritze aus Messing auf der Lokomotive herum. Einen Kilometer weit fort, in einer Kurve, hörte man das Schnaufen und Scheppern des Gegenzuges. Der Führer stand im schrägen Schatten des Bahnhofsgiebels, stürzte einen halben Liter Wasser herunter und trocknete dann das Gesicht und das dünne Haar mit einem großen fettigen Taschentuch. Als der Gegenzug kam, grüßten er und der Bahnhofsvorsteher müde; es war ein kraftloser Tag. (Martinson, Der Weg nach Glockreich/Johnson, Zeit der Unruhe. Stuttgart: Deutscher Bücherbund 1976, S. 397, bzw. Johnson, Erzählungen. Rostock 1974, S. 89)
När det tunga malmsättet stannade på sidospåret denna heta förkrigsdag, klev förarn, strax innan möteståget kom in, ner från loket och gick pustande över skenorna och bort till stinsen. På malmtåget satt bromsarna kvar, en del barhuvade med uppknäppta rockar och skjortor, och rökte Armirocigarretter ur trämunstycken. I gruset bakom stationen gick en höna tre varv runt regnmätarn. I basdiket rakt igenom den stora myren torkade vattnet långsamt upp eller surnade i färgskimrande pölar. Lokeldarn klättrade omkring på loket med en lång oljespruta av mässing. En kilometer bort, i en kurva, hörde man mötestågets dunk och skrammel: kopplingarna hängde slappa, de runda klumparna i åtdragen slängde som hundtungor. Förarn stod i den sneda skuggan vid stationshusets gavel och hällde i sig en halv liter vatten och torkade sedan ansiktet och det glesa håret med en stor, oljig näsduk. Då möteståget kom gjorde han och stinsen trött honnör: det var en energilös dag. (Eyvind Johnson, Sju liv, Stockholm 1944, S. 221)
In dieser ebenfalls durchaus zuverlässigen Übersetzung fällt auf: im Schwedischen „stand“ der Zug noch nicht, sondern hielt erst an. Den Lokführer im deutschen Text als „Führer“ einzuführen, heißt die Konnotationsweite der entsprechenden Bezeichnungen für „Führer“ / schwed. „ledare“, „vägvisare“ bzw. „förare“ zu unterschätzen. Und das Wasser, das langsam eintrocknet, deutet statt auf einen Sumpf, wie bereits beim Titel der Erzählung moniert, eher auf ein Moor.7Zum Vergleich H. C. Artmanns glänzende Übersetzung von Carl von Linnés Lappländischer Reise: „Gleich darauf begannen Moore, die meist unter Wasser standen. [… ] Das ganze Land dieses Lappen war meist Moor, hinc vocavi Styx. Niemals kann der Pfarrer die Hölle so beschreiben, daß dies hier nicht noch schlimmer wäre. Niemals haben die Poeten den Styx so häßlich ausmalen können, daß dies hier nicht häßlicher wäre. […] Ein Moor (das Lycksmoor, weil aus ihm ein Bach nach Lycksele fließt, cur non Unglücksmoor?) war voll von Ocker, und das Wasser trug eine tunica, denn es soll hier Sumpferz zur Eisengewinnung geben.“ (Carl von Linné, Lappländische Reise. Frankfurt/M.: Insel Taschenbuch 1975, S. 69 ff.). Und keine ausgewachsene Regentonne umkreist das Huhn, sondern einen kleinen Regenmesser.
So wenig Carlsson sich auch zu ihrer eigenen Arbeit als Übersetzerin geäußert hat, nahm sie doch als Rezensentin Stellung und betätigte sich dann auch gern als Übersetzungskritikerin. So urteilte sie in ihrer Besprechung von P. O. Sundmans Der Hahn und andere Erzählungen, nachdem sie etliche Belege für fehlerhafte Übersetzungen und Missverständnisse angeführt hatte: „Ein Schriftsteller vom Range Per Olof Sundmans hätte Anspruch auf einen kongenialen Übersetzer“.8„Jagdszenen in Jämtland. Per Olof Sundmans Erzählungen – unzulänglich übersetzt“. In: Die Zeit, 25. Mai 1973. Als einen solchen sah sie sich vermutlich selbst.
Anmerkungen
- 1Die Angaben zu ihrem Studium lt. „Lebenslauf“ in ihrer Dissertation von 1939.
- 2Die Angaben wurden den spärlichen Unterlagen im schwedischen Riksarkivet, Stockholm, entnommen.
- 3Ihre letzte Adresse war laut Berliner Telefonbuch von 1998/99: Lobeckstr. 48, Berlin-Kreuzberg. Tel. 614 25 52.
- 4Zwei Bücher des erzkonservativen, im Verlauf der 1930er Jahre immer frenetischeren NS-Apologeten Fredrik Böök erschienen auch im Deutschen Reich: Hitlers Deutschland von außen (München: Georg Callwey 1934) und Das reiche und das arme Schweden (Berlin: Reimar Hobbing 1938). Die Schrift von 1934 sei von Dr. Friedrich Crusius übersetzt, heißt es in einer „Schlußbemerkung“, und ohne Zusätze und Änderungen veröffentlicht worden, was Tomas Forser in seiner Abhandlung Bööks 30-tal (Stockholm 1976) korrigiert. Jedenfalls argumentiert Böök bereits 1933 vehement für eine Revision des Vertrags von Versailles, sonst sei ein Krieg unvermeidlich. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten sieht er als einen Wendepunkt, „weil Deutschlands Untergang den Untergang eines Europa bedeuten würde, in dem ich mich als Mitbürger gefühlt habe.“ (Böök, Hitlers Deutschland von außen, München 1934,S. 37). Vgl. auch sein Reisebuch Bil till Belgien. En sommarresa 1937. Stockholm 1937.
- 5„Sammle dich und kehre ein, / Lerne schauen, lerne lesen! / Sammle dich – und Welt wird Schein, / Sammle dich – und Schein wird Wesen.“
- 6Für ihre „poetischen“ Übersetzungen laut Postkarte aus Tübingen an mich vom 17. 9. 1992.
- 7Zum Vergleich H. C. Artmanns glänzende Übersetzung von Carl von Linnés Lappländischer Reise: „Gleich darauf begannen Moore, die meist unter Wasser standen. [… ] Das ganze Land dieses Lappen war meist Moor, hinc vocavi Styx. Niemals kann der Pfarrer die Hölle so beschreiben, daß dies hier nicht noch schlimmer wäre. Niemals haben die Poeten den Styx so häßlich ausmalen können, daß dies hier nicht häßlicher wäre. […] Ein Moor (das Lycksmoor, weil aus ihm ein Bach nach Lycksele fließt, cur non Unglücksmoor?) war voll von Ocker, und das Wasser trug eine tunica, denn es soll hier Sumpferz zur Eisengewinnung geben.“ (Carl von Linné, Lappländische Reise. Frankfurt/M.: Insel Taschenbuch 1975, S. 69 ff.).
- 8„Jagdszenen in Jämtland. Per Olof Sundmans Erzählungen – unzulänglich übersetzt“. In: Die Zeit, 25. Mai 1973.