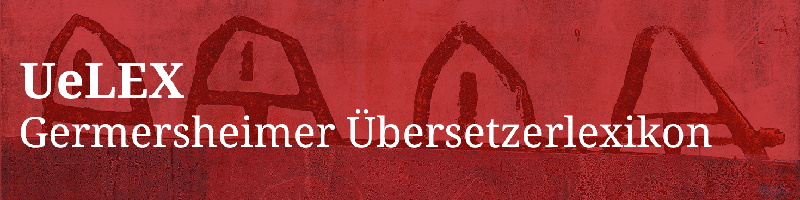Kai Molvig, 1911–1996
Kai Molvig war Tänzer und Pianist, bevor er Anfang der 1960er Jahre Übersetzer wurde. Er übersetzte etwa zwanzig Jahre lang vor allem amerikanische Autoren und Autorinnen und war, wie er selbst sagte, im Verlagsgeschäft als Übersetzer für Anzügliches bekannt.
Kai Molvig kam am 3. Mai 1911 als Johannes Jakobus Molvig in Riga zur Welt. Sein norwegischer Vater Alf war 1896 siebzehnjährig aus Oslo nach Riga gekommen und machte dort als Holzhändler bei der bedeutenden niederländischen Holzexportfirma Fijn van Draat Karriere. Die Familie Fijn van Draat war wohlhabend, ihre Rigaer Gründerzeitvilla steht heute unter Denkmalschutz. 1904 heiratete Alf Molvig Agneta Fijn van Draat, die in Riga geborene Tochter seines Chefs. Das Paar hatte drei Söhne, Kai war der jüngste. Alf war angesehen und offenbar finanziell sehr erfolgreich, er war auch norwegischer Konsul. 1923 verstarb er, nur 44-jährig, vermutlich blieb seine Witwe mit den Söhnen in Riga. Der Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, der Kai Molvig sehr gut kannte, erwähnte allerdings, dieser sei „mehrsprachig aufgewachsen, zuerst in Riga, später in Norwegen und dann in den Niederlanden“ (Ledig-Rowohlt 1981).1Diese Aufenthalte in Norwegen und in den Niederlanden werden nur von Ledig-Rowohlt erwähnt. Kais Bruder Helge gab Ende 1945 in einem Meldeformular an, seit 1927 in Deutschland zu leben. Seine Mutter kehrte in die Niederlande zurück. Sie wurde 1957 wieder eingebürgert und starb 1961 in Utrecht. Kai Molvig unterhielt offenbar auch Kontakte zu seiner norwegischen Familie, 1981 musste er „plötzlich aus traurigem Anlaß“ dorthin. Diese familiären Kontakte erlauben den Schluss, dass er zeitlebens Norwegisch und Niederländisch beherrschte. Berthold Forssman, Experte für Lettland und die lettische Sprache, hält es für wahrscheinlich
dass die Eltern Deutsch zumindest beherrschten und vermutlich auch in eine Kirche mit deutschen Gottesdiensten gingen, d. h. sich einer deutschen Gemeinde anschlossen. […] Vielleicht haben die Eltern sogar miteinander Deutsch gesprochen, wie binationale Paare heute manchmal Englisch als Drittsprache sprechen. (E-Mail, 6. Juni 2025.)
Tatsächlich gehörte die Familie der Reformierten Kirche an, die „vor allem Einwanderern aus den Niederlanden und anderen Calvinisten als Gotteshaus“ diente.2So die Information unter dem Stichwort Reformierte Kirche in einem Online-Reiseführer Riga. 1929 machte Kai – der damals noch „Hans“ hieß – am dortigen deutschsprachigen Neuhumanistischen Gymnasium das Abitur, ein letztes Mal tauchte er im folgenden Sommer mit einer bestandenen Buchhaltungsprüfung in einer Rigaer Zeitung auf.3Diese und weitere Informationen über die Familie Molvig in den Rigaer Jahren stammen aus verschiedenen Rigaer Zeitungen. Anfang der 1930er Jahre zog er nach Berlin, ob direkt aus Riga, ist ungewiss, und absolvierte eine Tanzausbildung in der Ballettschule von Tatjana und Victor Gsovsky. Es folgten Solotänzer-Engagements, 1935 bis 1938 in Mainz, bis 1941 in Düsseldorf, danach in Essen und schließlich München. Spätestens seit dem Mainzer Engagement trug er den androgynen Künstlernamen Kai Molvig (Sator 2020: 839). In den 1930er Jahren lernte er den Schauspieler Charles Regnier kennen, mit dem er ein Leben lang eng verbunden blieb. Anatol Regnier schrieb: „Ob mein Vater und er ein richtiges Verhältnis hatten, weiß ich nicht, aber irgendwie gehörten sie zusammen, als ob sie sich entschieden hätten, füreinander da zu sein“ (Regnier 2024: 309). 1941 heiratete Charles Regnier Pamela Wedekind, das Paar lebte ab 1942 mit Molvig in einer gemeinsamen Wohnung in München. Es sei „ein Dreierverhältnis, aber kein Dreiecksverhältnis“ gewesen, schreibt Armin Strohmeyr, eine Ménage-à-trois, die sie „etliche Jahre lang durchaus harmonisch führen“ (Strohmeyr 2020: 328). Darüber, wie der homosexuelle Molvig die Jahre des Nationalsozialismus in Berlin und den erwähnten anderen deutschen Großstädten er- und überlebt hat, ist nichts bekannt.
Nach dem Kriegsende trat er kaum noch als Tänzer auf und begann, als Pianist und Komponist zu arbeiten (Sator 2020: 839). Er begleitete Pamela Wedekind bei ihren Bühnenauftritten und „vertont in ihrem Auftrag Gedichte von Brecht, Walter Mehring und anderen“. (Regnier 2024: 259) Bei den Auftritten beeindruckte er nicht nur als Pianist: „Kai Molvig begleitete; etwas salopp, Salonstil, sehr weich und mit viel rhythmischem Empfinden. Ansonsten hätte man sich vielleicht die Adresse seines Schneiders aufnotieren sollen“ (Weick 1949). Der Komponist Hans Werner Henze nannte ihn „den Beau“ (Henze 1996). Anatol Regnier verehrte ihn und wollte als junger Mann „so elegant und lässig“ sein wie er, beschreibt ihn aber auch als „einen melancholischen Menschen, traurig, nie fröhlich. Sehr witzig.“
Privat war der schlanke und zierliche M., der seine Umwelt durch Originalität und Witz beeindruckte, ein Eigenbrötler, Spötter und Skeptiker, unsicher, schüchtern, scheu und sehr empfindsam. Er wirkte verschlossen und war oft sehr deprimiert, öffnete und entfaltet sich aber in intelligenten komischen und selbstironischen Briefen. (Sator 2020: 840)4Klaus Sator beruft sich auf Helmut Frielinghaus und Anatol Regnier, dankt ihnen für „weiterführende Informationen“ zu Molvig.
Nach dem Krieg begann er schwerhörig zu werden. Er musste eine neue Einkommensquelle finden und begann Ende der 1950er Jahre beruflich zum dritten Mal neu: Er wurde Übersetzer. Die Gründe sind nicht bekannt, aber es gibt Hinweise. Der Gedanke war vermutlich naheliegend, weil Charles Regnier und Pamela Wedekind nebenberuflich aus dem Französischen übersetzten, Regnier Theaterstücke, Wedekind Belletristik (Brüning 2020). Zudem war Molvig mehrsprachig, er hatte im Elternhaus Norwegisch und Niederländisch und in Riga Lettisch und Russisch gelernt, er sprach ein geschliffenes Deutsch, das seine baltische Herkunft verriet. Wie er sein hervorragendes Englisch erworben hatte, ist leider nicht bekannt. Er war nie in den USA und vermutlich auch in keinem anderen englischsprachigen Land (Allers 2008: 65). Er war, wie Regnier betonte, unendlich belesen, ein sehr kritischer Leser und ein hervorragender Stilist, besaß eine große Bibliothek, schätzte und verehrte Thomas Mann, Fontane und Stifter (Regnier: 2025). In seiner „Mehrsprachigkeit und im ständigen Umgang mit künstlerischen Ausdrucksformen“, so Ledig-Rowohlt, „liegen Anfang und Fundament dessen, was sich später, in der zweiten Hälfte seines Lebens, in einer neuen Laufbahn, im Umgang mit Sprache, fortsetzte“ (Ledig-Rowohlt 1981).
Alle, die mit ihm zu tun hatten, erwähnen, dass er Handarbeiten liebte. „Er strickte, häkelte und knüpfte und tat das auch in der Gegenwart ihm vertrauter Menschen“ (Sator 2020: 840); bei Ledig-Rowohlts Arbeitstreffen „häkelte Kai Molvig, der Selby-Übersetzer, abends beim Rotwein zierliche weiße Topflappen“ (Frielinghaus: 2008); Anatol Regnier erwähnt zahllose Strickarbeiten mit komplizierten, vielfarbigen Mustern.5Mitteilung von Anatol Regnier, Telefongespräch 3. Mai 2025. Diese Kompetenz ist für das Übersetzen durchaus relevant, denn anspruchsvolle Handarbeiten lehren vorausschauende Planung, äußerste Detailgenauigkeit und Frustrationstoleranz.
Um an Aufträge zu kommen, ergriff er die Initiative. Erhalten ist ein handschriftlicher Brief an den Insel-Verleger Fritz Arnold vom November 1960, in dem er A Legacy von Sybille Bedford zur Übersetzung vorschlug und eine dreiseitige Übersetzungsprobe beilegte.
Mrs. Bedford wäre damit einverstanden. Wenn es Ihnen nicht gefällt – hätten Sie dann vielleicht gelegentlich etwas Anderes für mich? Vorausgesetzt natürlich, daß Sie meine Übersetzungen „in Ordnung“ finden. (Insel Verlagsarchiv, DLA)
Arnold fand sie „sehr brauchbar“, doch das Buch passe nicht zu Insel (ebd.). Die erste Übersetzung, die der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek für ihn verzeichnet, ist der Roman Meine Kinder essen Torf des Niederländers Toon Kortooms, der 1961 im Rex-Verlag erschien. Wie es dazu kam, ist nicht bekannt, möglicherweise hatte Molvig persönliche Kontakte zu der in München ansässigen Niederlassung des Schweizer Verlags. Auch seine zweite und dritte Übersetzung waren Kortooms-Romane, danach übersetzte er nur noch aus dem Englischen, und zwar vorwiegend zeitgenössische amerikanische Autoren und Autorinnen. Die ersten Übersetzungen für Rowohlt waren 1967 Terry Southern Candy oder die sexte der Welten und 1968 Hubert Selby Letzte Ausfahrt Brooklyn. Im Juni 1968 schrieb der Rowohlt-Lektor Fritz Raddatz an Molvig, seine Arbeit an den Marginalientexten
für den Selby [ist] wie alle Ihre Arbeiten wieder ganz ausgezeichnet, und ich stimme auch mit Ihnen überein, daß es sicherlich richtig ist, diesen Text – wie Sie sagen – „nicht auf Edeldeutsch zu trimmen“. (Rowohlt Verlagsarchiv, DLA)
Nachdem er für Rowohlt drei Titel übersetzt hatte, bot ihm der Verlag 1968 einen fünfjährigen „Ausschließlichkeitsvertrag“ an: Er würde exklusiv für den Rowohlt Verlag übersetzen und dafür ein monatliches Fixum von DM 875 erhalten; Ledig-Rowohlt erhöhte die „Monatsrate ab 1.1.72 auf DM 1.250″.6Eine solche de facto-Anstellung eines Übersetzers war und ist im (west)deutschen Verlagsgeschäft sehr unüblich, aber nicht einzigartig. Zu den bekanntesten Fällen zählen Traugott König, der vom Rowohlt Verlag für die Sartre-Übersetzungen einen Anstellungsvertrag mit einem Lektorengehalt erhielt, sowie Hans Wollschläger, dem der Suhrkamp-Verlag während der (langjährigen) Arbeit an James Joyce‘ Ulysses ein monatliches Fixum zahlte. Vereinbart wurde auch, dass Molvig die Übersetzungen auf Band sprechen und diese Tonbänder an den Verlag schicken würde, der sie dann (auf Verlagskosten) von einer Typistin abschreiben ließ. Die sich daraus ergebenden Probleme mit der Bereitstellung und der Kompatibilität von Diktiermaschinen, Abspielgeräten und Bändern waren in den Vertragsjahren Gegenstand zahlloser Briefe.
Molvig bat häufig darum, das Lektorat nicht brieflich, sondern „im Team“ zu machen. Der damalige Rowohlt-Lektor Helmut Frielinghaus erklärte, es habe
in fast jedem Programm Bücher [gegeben], auf deren Übersetzung Ledig selbst Einfluss nehmen wollte. In solchen Fällen zog er sich mit einem „Team“ – dem Leiter der Übersetzungsabteilung und dessen Assistentin, dem Übersetzer, wenn der dabei sein sollte, oder einem weiteren Lektor und seiner Frau, Jane – für drei, vier Tage, manchmal auch für eine ganze Woche in einen entlegenen Gasthof in Schleswig-Holstein oder in der Lüneburger Heide zurück, zur Arbeit „an der Front“, wie er den Geschäftsführern versicherte, wenn die über seine langen Abwesenheiten oder über die, wie sie fanden, überflüssige Geldausgabe stöhnten. (Frielinghaus 2008: 10)
1971 bat Molvig Ledig-Rowohlt
für diesen SELBY um ein Team. Ich glaube, daß einige Partien mir gut gelungen sind, bei anderen bin ich unsicher. Es sind so viele „Ermessensfragen“ drin – was der Autor mit diesem und jenem sagen will – dazu die pausenlose Verwendung des Wortes „Scheiße“ (pardon), das sich ja bekanntlich in den meisten Fällen als einziges für das pausenlose „fucking“ anbietet, dazu die Frage, ob man die schier endlosen Wiederholungen wirklich so stereotyp mitmachen, oder nicht doch einiges streichen soll, etc. etc. (Rowohlt Verlagsarchiv, DLA)
Ebenfalls 1971 schrieb er über John Updikes Rabbit redux:
Dieses Buch wirft für mich ziemlich neue Probleme auf. Ich verstehe so vieles nicht (d. h. endlose Recherche, die ich so liebe) und man sollte wohl längere Zeit in Amerika gewesen sein, um es zu übersetzen. (Ebd.)
Die Übersetzung erschien 1973 als Unter dem Astronautenmond. Mit dem schriftlichen Lektorat dieses Romans war er sehr unzufrieden. Als Frielinghaus ein „Team“ für Eudora Welty An Optimist’s Daughter als zu aufwändig ablehnte, protestierte er:
Es hat sich bei UPDIKE eindeutig herausgestellt, daß dieser Weg für mich wenig taugt. Das war auch Frau Hohlweins Meinung und wir beschlossen, damals, es nicht noch einmal so zu machen. Es bleibt zu viel offen, auch bei einem relativ kurzen Buch. Von mir wird dann erwartet, daß ich ad hoc eine neue Lösung finde, wenn ein Änderungswunsch besteht, ich weiß von dieser eventuellen neuen Lösung nicht, ob sie Beifall findet usw. usf. (Ebd.)7Liselotte Hohlwein war viele Jahre Assistentin der Übersetzungsabteilung.
Bei An Optimist’s Daughter bat Molvig Ledig-Rowohlt, zwei Gedichte zu übersetzen, die Welty in dem Buch zitiert. Er, Molvig, könne sie nicht übersetzen, was er nicht erklärt, die Gründe scheinen allen Beteiligten bekannt. Ledig-Rowohlt übersetzte die Gedichte, wird aber im Buch nicht genannt.8Die Autoren sind William Holmes McGuffey (1800-1873) und Robert Southey (1774 –1843). Die Tochter des Optimisten, Rowohlt 1973.
Das Verhältnis zwischen ihm und Molvig war von gegenseitiger Zuneigung geprägt. Anatol Regnier erinnert sich an Molvigs Bemerkung, dass „Ledig ihn sehr gemocht“ habe.
Molvig wusste offenbar genau, was er konnte – und was nicht. 1973 lehnte er John Gardners The Sunlight Dialogues ab, weil es
zu viele „mir“ unverständliche Amerikanismen und Americana (gleichbedeutend mit schier endlosen Recherchen, die mich immer ganz fertigmachen) [enthält], zu viel Assoziationswirrsal, die hin und wieder alles oder nichts bedeuten kann und somit jeder Interpretation offen steht. (Rowohlt Verlagsarchiv, DLA)
Auch Ledig-Rowohlts Versicherung, man könne doch die Schwierigkeiten vielleicht gemeinsam lösen, vermochte ihn nicht umzustimmen.9Der Roman erschien 1977 in der Übersetzung von Hermann Stiehl unter dem Titel Der Ruhestörer oder die Gespräche mit dem Sonnen-Mann.
Im Laufe der Jahre erwähnte er mehrfach einen „Amerikaner“, der ihm half. Wie das vergütet wurde, bleibt offen. Einmal bestätigte der Verlag, 500 DM gezahlt zu haben, und fragte Molvig, ob man ihm für einen ungewöhnlich hohen Arbeitsaufwand statt eines zusätzlichen Honorars Bücher im Wert von 100 Mark anbieten könne. Gelegentlich kontaktierte der Verlag per Telex eine Kontaktperson in New York, um unbekannte Ausdrücke zu klären.
Der im Dezember1968 geschlossene Exklusivvertrag endete im Oktober 1973. Im Januar 1974 bat Molvig den Verlag um drei Monate Urlaub. Frielinghaus informierte Kurt Busch, den Geschäftsführer für Finanzen und Verwaltung, dass Ledig-Rowohlt dem bei halbem Monatsgehalt zustimme, und fuhr fort:
Grundsätzlich sind wir nicht daran interessiert, Herrn Molvig noch auf längere Zeit durch einen Exclusivvertrag an uns zu binden, da es bei der Verlagerung der Schwerpunkte des Verlagsprogramms immer schwieriger wird, ihm die entsprechenden Aufträge in genügendem Umfang zu geben und wir Herrn Molvig andererseits nicht als Sachüberübersetzer heranziehen können. (Rowohlt Verlagsarchiv, DLA).
Man werde den Vertrag zum 30. April 1975 auslaufen lassen. Das teilte er Molvig wenig später mit und versuchte auch, ihn zur Übersetzung anderer Bücher sowie dazu zu bewegen, seine Manuskripte künftig selbst zu tippen. Das wollte er keinesfalls: „Solange Herr Ledig mir dieses Entgegenkommen bezüglich der Herstellung meiner Manuskripte nicht entzieht, kann ich nicht darauf verzichten“, worauf Frielinghaus etwas schmallippig richtigstellte, es handele sich „um ein Entgegenkommen des Verlages“ (Ebd.). Tatsächlich erwähnte Molvig häufig, wie erbärmlich er Maschine schrieb, Anatol Regnier erinnerte sich:
Er arbeitet gewissenhaft, setzt sich selbst unter Druck, vertippt sich oft und kämpft mit Tipp Ex und zusammengeklebten Manuskriptseiten. (Regnier 2024: 263)
Nach sechs Jahren und zwölf Titeln beendete der Verlag den Vertrag zum 30. April 1975 mit den Worten: „Wir hoffen, dass sich auch danach noch hin und wieder Gelegenheit zu einer Zusammenarbeit bietet.“ Tatsächlich übersetzte er „auch danach noch hin und wieder“ für Rowohlt; im Sommer 1977 flehte Ledig-Rowohlt ihn geradezu an, den „neuen Selby“ zu übernehmen, man sei bereit, dafür das geplante Erscheinungsdatum zu verschieben. Molvig nutzte die Gunst der Stunde und bat um die Veränderung der Nebenrechtsklausel „wie die bei Fischer für Jong“: „Der Übersetzer erhält von der 2. Auflage der hardcover-Ausgabe an 1% des verkauften und bezahlten Exemplars [sic].“ Ledig-Rowohlt versuchte es mit dem Angebot, „Sie nach 10.000 verkauften Exemplaren mit 1% vom Warenwert zu beteiligen.“ Als Molvig beharrte, ging er „nur für diesen Vertrag“ darauf ein (Rowohlt Verlagsarchiv, DLA).
In den Jahren des Vertrages erhielt Molvig ein außergewöhnlich hohes Honorar von 25 DM pro Normseite. Als Frielinghaus 1979 bei erneuten Honorarverhandlungen geltend machte, das sei „das höchste Übersetzerhonorar, das wir zahlen“, antwortete Molvig:
Ich weiß, daß ich gut bezahlt werde, im Rahmen des Üblichen. […] Trotzdem werde ich mich bis zur Bahre nicht damit abfinden, daß der Stundenlohn meiner Putzfrau (die ich mir einmal im Monat leiste, da ich es allein nicht mehr schaffe) den meinen übersteigt. Ebensowenig, wie damit, daß alle Verlage so tun, als gäbe es keine Geldentwertung. (Ebd.)10In diesem Brief fragt er auch spöttisch, ob Frielinghaus behaupten wolle, dass sich Dieter E. Zimmer für seine Nabokov-Übersetzung mit weniger als 25 DM zufriedengebe. Frielinghaus musste einräumen, dass das nicht der Fall war.
Wegen des Lektorats von Selbys Dämon kam es 1980 zwischen Frielinghaus und Molvig zu einem im Ton ungewöhnlich scharfen Briefwechsel. Molvig fand das Lektorat einer „freien Mitarbeiterin“ furchtbar, sie habe eine Tendenz zu „Banalisierung und Simplifizierung“, was ihn so verbitterte, dass er den Brief mit dem Vorschlag schließt:
Lassen Sie alles so, wie von Frau Schmidt geändert, und nennen Sie eine fiktive Person als Übersetzer. Das würde Zeit und Geld sparen und täte niemandem weh. Von meiner Person will ich in diesem Zusammenhang schweigen. (Ebd.)
Frielinghaus reagierte sehr verärgert, wofür er sich wenig später entschuldigte. Auch Molvig ruderte zurück: „Ich wollte Sie meinerseits nicht verletzen. Das will ich, glaube ich, nie. Da ich es aber getan habe, bitte ich Sie herzlich um Entschuldigung.“ (Ebd.)
In den Rowohlt-Jahren hatte Molvig sich im Verlagsgeschäft, wie er einer Lektorin sagte, einen Namen als Übersetzer für Anzügliches gemacht.11Gespräch mit Ursula Köhler, 6. Mai 2025. In einem privaten Gespräch sagte er einmal amüsiert: „Ich übersetze gerade wieder ein besonders schweinisches Buch.“ 12Mitteilung von Anatol Regnier, Telefongespräch 3. Mai 2025. Vielleicht deswegen bot ihm der Fischer Verlag die Übersetzung des Skandalbuches Angst vorm Fliegen von Erica Jong an, das 1976 erschien. Anatol Regnier erwähnt, die damalige Fischer-Lektorin Ursula Köhler habe sich zum 45. Jubiläum von Angst vorm Fliegen an einen Brief Kai Molvigs erinnert,
der mit „Sehr geehrte gnädige Frau“ begann und ihr dann alle Fehler auseinandersetze, die sie seiner Meinung nach bei der Redaktion gemacht habe. Sie habe viel dabei gelernt, meint sie, geradezu ein Schlüsselerlebnis sei das gewesen. (Regnier 2024: 263f.)
Köhler hatte das Buch als junge, unerfahrene Lektorin auf den Tisch bekommen, weil ihre männlichen Kollegen damit nichts zu tun haben wollten. Sie bemühte sich, „das Buch ins Bürgerliche zu lektorieren“, was Molvig nicht duldete. In dem erwähnten, ausführlichen, sehr höflichen und liebeswürdigen Brief habe er Verständnis für ihre Situation gezeigt, sie aber ganz grundsätzlich korrigiert: Schweinisches, schrieb er wörtlich, müsse man schweinisch übersetzen. Köhler war von dem Brief so begeistert, dass sie ihn ans Schwarze Brett hängte (Köhler 2025).
Molvig war seit 1971 Mitglied im Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke, VdÜ, 1981 wurde er der zweite Träger des Hieronymusrings.13„Im Jahr 1979, als es außer dem Johann-Heinrich-Voß-Preis sowie dem Helmut-M. Braem Preis noch keine weiteren Übersetzerpreise gab, und Ledig die langjährige Rowohlt-Übersetzerin Susanna Brenner-Rademacher ehren wollte, kam er zusammen mit seinem Lektor Helmut Frielinghaus auf die Idee, nach dem Vorbild des Iffland-Rings, mit dem Schauspieler für besondere Leistungen geehrt werden, einen Übersetzerring zu stiften. Der Ring wurde nach dem Schutzheiligen der Übersetzer, dem Heiligen Hieronymus, benannt und sollte unter den Übersetzern selbst weitergereicht werden. Eine Dotierung war nicht vorgesehen. Der Übersetzerin Susanna Brenner-Rademacher wurde der Ring in einer feierlichen Zeremonie in Anwesenheit des Verlegers, des Lektors und von Ursula Brackmann überreicht.“ (Höbel/Kelletat 2023) Zweiter Stifter war der Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke, VdÜ. Der eigens angefertigte Ring wird für die Dauer von zwei Jahren verliehen. Der Preisträger, bzw. die Preisträgerin soll ihn an jemanden weitergeben, der oder die „wie sie im verborgenen wirkt und nach ihrer Ansicht zu Unrecht nirgends preisgekrönt wurde“. Der Preis war 1979 anlässlich des 80. Geburtstags der Englisch-Übersetzerin Susanna Brenner-Rademacher gestiftet worden. Sie war auch die erste Preisträgerin, verstarb aber, bevor sie ihn weitergeben konnte. In einem Brief an Molvig verriet Frielinghaus, wie es dazu kam, dass der Ring an ihn ging: „Die Idee, daß Sie den Preis nun tragen sollen, ist von den Übersetzern, ich nehme an Frau Brackmann und Herrn Birkenhauer, gekommen.“ Molvig bedauerte, nicht zur Verleihung nach Bergneustadt reisen zu können. „Diese Anerkennung meiner Arbeit hat mir wohlgetan“, aber seine „leidige Harthörigkeit“ mache „ein Zusammensein mit Menschen in größerem Kreis einfach sinnlos“ (Rowohlt Verlagsarchiv, DLA).
In seiner Laudatio nannte Ledig-Rowohlt „den Einsiedler in München“ einen „genauen Beobachter, der über die Unvollkommenheit der Welt und der Menschen, seine eigene Person eingeschlossen, die bissigsten und witzigsten Kommentare abzugeben weiß“. Er erwähnte seine Schwerhörigkeit, „die ihn auf eine besondere Weise hellhörig zu machen scheint“, rühmte seine Kenntnis der Welt und seine „natürliche künstlerische Phantasie, die durch die Jahre der Zurückgezogenheit offenbar noch verstärkt wurde“ (Rowohlt Verlagsarchiv, DLA; vgl. Wenke 1982).
Molvig gab den Ring 1983 an Inge von Weidenbaum und Christine Koschel für deren Übertragung des Theaterstücks Antiphon von Djuna Barnes.
Zwischen 1960 und 1980 übersetzte er dreißig Titel, vor allem amerikanische Autoren wie Philip Roth, Hubert Selby, James Baldwin, John Updike, Eudora Welty, Tennessee Williams, Erica Jong. Er übersetzte auch Theaterstücke und Sachtexte, in den 1970er Jahren arbeitete er mindestens einmal für den deutschen Playboy. Seine vermutlich letzten Arbeiten waren 1981 Michael Korda, Immer nur vom Feinsten, für Piper, und Hubert Selby, Requiem für einen Traum, für Rowohlt.
Seine Übersetzungen wurden auch Jahre nach Erscheinen noch geschätzt. Als 2009 Philip Roths Portnoys Beschwerden in der Neuübersetzung von Werner Schmitz erschien, warfen einige Rezensenten einen Blick in die Molvig-Übersetzung von 1970. In der Süddeutschen Zeitung hieß es, es sei „einfach eine Freude, gleich zwei gute Übersetzungen von Roths ebenso komischen wie obszönen Roman zur Auswahl zu haben“ (Müller 2009), der Rezensent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hielt die Neuübersetzung für „eine Spur genauer“ und stilistisch oft für etwas besser; im Blick auf die Wortspiele und den „frechen kolloquialen Ton“ des Originals komme die Neuübersetzung allerdings nicht an die alte Fassung heran (Koppenfels 2009). Der Schriftsteller, Literaturkritiker und Übersetzer Jan Wilm besprach 2015 die Neuauflage des Romans Die Preisgabe, noch zehn Jahre später rühmt er „die Übersetzung von James Purdy durch Molvig [als] sehr gut, zärtlich, sanft, lyrisch, sehr gut lesbar“ (E-Mail, Mai 2025).
Die bislang letzte Neuübersetzung eines Molvig-Titels ist Erica Jongs Angst vorm Fliegen. Sie stammt von Lilian Peter und war 2025 für den Leipziger Buchpreis nominiert. Peter schreibt in ihrem Nachwort:
Hätte eine Übersetzerin 1976 noch den Ausdruck „Weib“ benutzt? Haben Frauen je davon gesprochen, „eine Nummer [zu] schieben“? Warum hat sich der Übersetzer entschieden, „my writing“ mitunter als „meine Schreiberei“ zu übersetzen statt mit „mein Schreiben“, wenn die Protagonistin über ihre eigene Arbeit spricht? (Peter: 520f.)14Solche Überlegungen sind nicht neu. Die Übersetzerin Eva Bornemann schrieb 1982: „Gewiß bekomme ich als Frau und als einigermaßen bekannte und versierte Übersetzerin neuerdings viel ‚Frauentexte‘, will sagen Bücher, die von Frauen für eine vorwiegend weibliche Leserschaft geschrieben sind. Der Verlag sagt dann immer: ‚Ja, das Buch kann doch nur eine Frau übersetzen!‘ Und kritische weibliche Kollegen, die zum Beispiel das von Kai Molvig übertragene Buch von Erica Jong, Fear of Flying (Angst vorm Fliegen) gelesen hatten, stimmten zu: Das hätte besser einer Frau zur Übersetzung gegeben werden sollen.“ Bornemann vertritt in dem Vortrag die Ansicht, dass das Geschlecht des Übersetzenden keine Rolle spiele (Bornemann 1982).
Die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Sula Textor hat sich eingehend mit der Neuübersetzung befasst. Sie stimmt Peter in dieser Beobachtung zu, allerdings in eingeschränkter Weise:
„’Schreiberei‘ etwa verwendet Kai Molvig eben keineswegs immer, wenn die Erzählerin von ihrem ‚writing‘ spricht, sondern gezielt in wenigen, gut begründbaren Einzelfällen (die Erzählerin kämpft ja selbst lange damit, ihr Schreiben ernst zu nehmen; sie hat das, was man als misogyne Abwertung in ‚Schreiberei‘ lesen könnte, selbst verinnerlicht und muss sich erst davon freimachen). Allerdings habe ich die Übersetzungen nicht im Detail verglichen, kann also nicht ausschließen, dass sich an einigen Stellen doch auch eine zusätzliche Abwertung eingeschlichen hat. Das gleiche gilt für ‚Weib‘ und Komposita auf ‚Weiber‘-, wobei sich darüber sicher streiten lässt und es bestimmt auch in den 70ern ÜbersetzerINNEN gegeben hätte, die so nicht übersetzt hätten. Darüber hinaus gibt es ein paar weitere Feinheiten bei der Wortwahl, besonders im Kontext von Beschreibungen weiblicher Lust, Benennung von Körperlichem, wo man von einem feministischen Standpunkt aus wohl anders übersetzt hätte. Meinem Eindruck nach waren es nur Details, die die Übersetzung als Text ihrer Zeit kennzeichnen, ihre Qualität aber kaum schmälern.“ (E-Mail, Juni 2025)
„Das Ende kommt“, schreibt Anatol Regnier, „als Kai Molvig einem Zivi, der ihn ein Jahr lang betreut hat, einen Ballettsprung zeigen will. Dabei stürzt er und bricht sich eine Hüfte.“ Die Operation gelingt, aber er will nicht mehr. 1996 stirbt er nach kurzem Aufenthalt in einem Pflegeheim in Moosburg an der Isar an den Folgen eines Schlaganfalls. „Er wird anonym bestattet, das wollte er so“ (Regnier 2024: 265).
Hinweise für weitere Recherchen
Es gibt keine Arbeiten zu Kai Molvigs Biografie und übersetzerischem Werk, ein Nachlass existiert nicht. Das Literaturarchiv Marbach besitzt eine umfangreiche Korrespondenz zwischen Kai Molvig und Angestellten des Rowohlt-Verlages aus den Jahren 1968 bis 1984. Dokumente zur Jong-Übersetzung könnten sich in den Teilen des ebenfalls dort lagernden Archivs des Fischer-Verlags befinden, die (Stand Herbst 2025) noch nicht erschlossen sind.
Anmerkungen
- 1Diese Aufenthalte in Norwegen und in den Niederlanden werden nur von Ledig-Rowohlt erwähnt. Kais Bruder Helge gab Ende 1945 in einem Meldeformular an, seit 1927 in Deutschland zu leben. Seine Mutter kehrte in die Niederlande zurück. Sie wurde 1957 wieder eingebürgert und starb 1961 in Utrecht. Kai Molvig unterhielt offenbar auch Kontakte zu seiner norwegischen Familie, 1981 musste er „plötzlich aus traurigem Anlaß“ dorthin. Diese familiären Kontakte erlauben den Schluss, dass er zeitlebens Norwegisch und Niederländisch beherrschte.
- 2So die Information unter dem Stichwort Reformierte Kirche in einem Online-Reiseführer Riga.
- 3Diese und weitere Informationen über die Familie Molvig in den Rigaer Jahren stammen aus verschiedenen Rigaer Zeitungen.
- 4Klaus Sator beruft sich auf Helmut Frielinghaus und Anatol Regnier, dankt ihnen für „weiterführende Informationen“ zu Molvig.
- 5Mitteilung von Anatol Regnier, Telefongespräch 3. Mai 2025.
- 6Eine solche de facto-Anstellung eines Übersetzers war und ist im (west)deutschen Verlagsgeschäft sehr unüblich, aber nicht einzigartig. Zu den bekanntesten Fällen zählen Traugott König, der vom Rowohlt Verlag für die Sartre-Übersetzungen einen Anstellungsvertrag mit einem Lektorengehalt erhielt, sowie Hans Wollschläger, dem der Suhrkamp-Verlag während der (langjährigen) Arbeit an James Joyce‘ Ulysses ein monatliches Fixum zahlte.
- 7Liselotte Hohlwein war viele Jahre Assistentin der Übersetzungsabteilung.
- 8Die Autoren sind William Holmes McGuffey (1800-1873) und Robert Southey (1774 –1843). Die Tochter des Optimisten, Rowohlt 1973.
- 9Der Roman erschien 1977 in der Übersetzung von Hermann Stiehl unter dem Titel Der Ruhestörer oder die Gespräche mit dem Sonnen-Mann.
- 10In diesem Brief fragt er auch spöttisch, ob Frielinghaus behaupten wolle, dass sich Dieter E. Zimmer für seine Nabokov-Übersetzung mit weniger als 25 DM zufriedengebe. Frielinghaus musste einräumen, dass das nicht der Fall war.
- 11Gespräch mit Ursula Köhler, 6. Mai 2025.
- 12Mitteilung von Anatol Regnier, Telefongespräch 3. Mai 2025.
- 13„Im Jahr 1979, als es außer dem Johann-Heinrich-Voß-Preis sowie dem Helmut-M. Braem Preis noch keine weiteren Übersetzerpreise gab, und Ledig die langjährige Rowohlt-Übersetzerin Susanna Brenner-Rademacher ehren wollte, kam er zusammen mit seinem Lektor Helmut Frielinghaus auf die Idee, nach dem Vorbild des Iffland-Rings, mit dem Schauspieler für besondere Leistungen geehrt werden, einen Übersetzerring zu stiften. Der Ring wurde nach dem Schutzheiligen der Übersetzer, dem Heiligen Hieronymus, benannt und sollte unter den Übersetzern selbst weitergereicht werden. Eine Dotierung war nicht vorgesehen. Der Übersetzerin Susanna Brenner-Rademacher wurde der Ring in einer feierlichen Zeremonie in Anwesenheit des Verlegers, des Lektors und von Ursula Brackmann überreicht.“ (Höbel/Kelletat 2023) Zweiter Stifter war der Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke, VdÜ. Der eigens angefertigte Ring wird für die Dauer von zwei Jahren verliehen. Der Preisträger, bzw. die Preisträgerin soll ihn an jemanden weitergeben, der oder die „wie sie im verborgenen wirkt und nach ihrer Ansicht zu Unrecht nirgends preisgekrönt wurde“.
- 14Solche Überlegungen sind nicht neu. Die Übersetzerin Eva Bornemann schrieb 1982: „Gewiß bekomme ich als Frau und als einigermaßen bekannte und versierte Übersetzerin neuerdings viel ‚Frauentexte‘, will sagen Bücher, die von Frauen für eine vorwiegend weibliche Leserschaft geschrieben sind. Der Verlag sagt dann immer: ‚Ja, das Buch kann doch nur eine Frau übersetzen!‘ Und kritische weibliche Kollegen, die zum Beispiel das von Kai Molvig übertragene Buch von Erica Jong, Fear of Flying (Angst vorm Fliegen) gelesen hatten, stimmten zu: Das hätte besser einer Frau zur Übersetzung gegeben werden sollen.“ Bornemann vertritt in dem Vortrag die Ansicht, dass das Geschlecht des Übersetzenden keine Rolle spiele (Bornemann 1982).