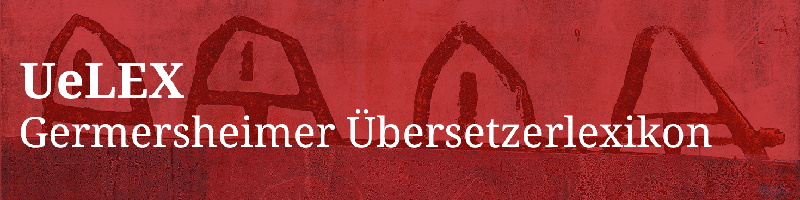Mathilde Mann, 1859–1925
Mathilde Mann war zwischen 1885 und 1924 eine der produktivsten Übersetzerinnen skandinavischer Literatur. In diesen fast vierzig Jahren übertrug sie mehr als 140 Werke aus dem Dänischen, Norwegischen und Schwedischen. Neben dem gesamten Prosawerk von Jens Peter Jacobsen übersetzte Mathilde Mann fünf skandinavische Nobelpreisträger: Bjørnstjerne Bjørnson, Selma Lagerlöf, Henrik Pontoppidan, Knut Hamsun und Johannes V. Jensen. Zu ihren größeren Erfolgen gehörten auch Übersetzungen von Hans Christian Andersen, Martin Andersen Nexø und Karin Michaëlis. Im Gegensatz zu vielen anderen Übersetzerinnen benutzte sie nie ein männliches Pseudonym. Was Mathilde Mann ebenfalls von ihren zeitgenössischen Kolleginnen und Konkurrentinnen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie als alleinerziehende Mutter den Lebensunterhalt für sich und ihre beiden Kinder durch das Übersetzen verdiente.
Der deutsche Buchmarkt war für Skandinavien schon immer das Tor zur Weltliteratur, wie es der Göttinger Skandinavist Fritz Paul prägnant formuliert hat (Paul 1997: 194). Der Erfolg von Henrik Ibsen in Deutschland – das sogenannte Ibsen-Fieber – führte dazu, dass auch andere skandinavische Autoren, zunächst Dramatiker, später auch Romanautoren, in Deutschland bekannt und erfolgreich wurden. Von 1880 bis 1914 nahm die skandinavische Literatur eine führende Stellung ein, und in genau dieser Zeit war Mathilde Mann als Übersetzerin tätig. In einem Artikel in der dänischen Zeitung Politiken vom November 1894 über den „Literatur-Export nach Deutschland“ heißt es, dass Literatur neben Butter das wichtigste dänische Exportgut sei. Mathilde Mann wird hier als eine der bedeutendsten Vermittlerinnen nordischer Literatur in Deutschland vorgestellt (Anon. in Politiken, 11. November 1894).
Mathilde Mann übersetzte vor allem Belletristik, aber auch Reiseliteratur, kunsthistorische Sachbücher und sogar ein Kochbuch. Da sie von der Übersetzung von Literatur lebte, musste sie sich dem Markt anpassen. Noch heute sind einige von Mathilde Manns Übersetzungen erhältlich, denn viele skandinavische Klassiker wurden seither nicht mehr neu ins Deutsche übertragen.
Biografie
Mathilde Charlotte Bertha Friederike Mann, geborene Scheven, kam am 24. Februar 1859 als Tochter eines Medizinalrats in Rostock zur Welt. Über ihre Kindheit ist nicht viel bekannt, sicher ist, dass sie viele Sprachen erlernte. Neben Dänisch, Norwegisch und Schwedisch soll sie auch Englisch, Französisch und Italienisch beherrscht haben.
Mit 19 Jahren heiratete sie 1878 den Kaufmann Friedrich Johann Bernhard Mann, der mit den später berühmt gewordenen Manns aus Lübeck verwandt und dänischer Konsul in Rostock war. Das Paar bekam zwei Kinder, 1879 die Tochter Anna Catharina und im Jahr darauf den Sohn Johann Bernhard. Aber schon wenige Jahre später wurde das junge Familienglück getrübt: F. J. Bernhard Manns Firma ging 1885 in Konkurs, und ihm drohte eine Gefängnisstrafe. Er verlor seinen Titel als Konsul, durch Bittbriefe, die er und seine Frau 1887 an den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin richteten, erreichte er immerhin eine Begnadigung (Kalbe 2002: 98). Zu diesem Zeitpunkt war die Familie bereits nach Kopenhagen umgezogen, da F. J. Bernhard Mann in Rostock keine berufliche Zukunft mehr hatte. Das Ende seiner Karriere läutete den Beginn des Berufslebens seiner Frau ein. Zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Kopenhagen im Jahr 1885 begann sie zu übersetzen – eine naheliegende Beschäftigung für eine Frau und Mutter ohne Berufsausbildung, die aber im Elternhaus Fremdsprachen erlernt hatte. Bereits fünf Jahre später kam es zu einem weiteren Umbruch in ihrem Leben, denn im Jahr 1890 trennte Mathilde sich von Bernhard Mann (Brief an Sophus Bauditz, 24. April 1890), und dreieinhalb Jahre später folgte die Scheidung. Ihr Mann habe schwere psychische Probleme gehabt, schreibt sie in einem Brief an den Schriftsteller Erik Skram (Brief an Erik Skram, 15. Dezember 1894).1Die Briefe von Mathilde Mann an Sophus Bauditz, Holger Drachmann, Peter Nansen, Amalie Skram und Erik Skram sowie die Briefe von Peter Egge, Jakob Knudsen, Karin Michaëlis und Henrik Pontoppidan an Mathilde Mann befinden sich in Det Kongelige Bibliotek (Die Königliche Bibliothek) in Kopenhagen. Sie behielt die Kinder, für die sie nun allein sorgen musste, weil sie keinen Unterhalt erhielt (Brief an Erik Skram, 2. März 1891).
Aus den Quellen geht hervor, dass Mathilde Mann auch privat Deutschunterricht gab, um Geld zu verdienen, (Universitätsarchiv Rostock, 1.11.0 Personalakte Mathilde Mann) und dass sie vom See-Amt in Rostock als staatlich geprüfte Dolmetscherin für die nordischen Sprachen vereidigt wurde (Brief an Peter Nansen, 23. November 1894). Von 1893 bis 1895 wohnte sie in Warnemünde.
Ab 1895 kümmerte sie sich sieben Jahre lang um den Haushalt ihres Schwagers Otto Giese, der Bürgermeister in Hamburg-Altona war, und um die Erziehung seiner drei kleinen Kinder, die ihm Mathilde Manns Schwester hinterlassen hatte. Ihre eigenen Kinder waren im Internat in Warnemünde. Während dieser Zeit in Altona übersetzte sie unter anderem Werke von Peter Nansen, aber auch von Amalie Skram, Bjørnstjerne Bjørnson, Sophus Scandorph, Sophus Bauditz und Jonas Lie.
Mathilde Mann spricht oft und sehr direkt über ihre prekäre finanzielle Lage: So geht z. B. aus einem Interview anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums hervor, dass „Armut“ sie gezwungen habe, mit dem Übersetzen zu beginnen (Anon. in Politiken, 14. November 1910), aber ebenso oft schreibt sie ihren Briefpartnern, wie viel Freude ihr die Arbeit mache (z. B. in Briefen an Peter Nansen, 17. Mai 1892 und 9. Januar 1915) Ihr größter Stolz sei, dass sie ihre beiden Kinder allein habe großziehen können und dass aus ihnen etwas geworden sei: Ihr Sohn machte in der Marine Karriere, ihre Tochter heiratete einen dänischen Maler (Anon. in Politiken, 14. November 1910). 1907 zog Mathilde Mann nach Kopenhagen zurück, wo auch ihre Tochter Anka und ihr Schwiegersohn Oscar Matthiesen lebten.
1910, als sie ihr 25-jähriges Jubiläum als Übersetzerin feierte, wurde ihr die königliche Goldmedaille für Kunst und Wissenschaft „Ingenio et arti“ verliehen, wie die dänische Tageszeitung Politiken berichtete (Anon. in Politiken, 14. November 1910).
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ging die Blütezeit der skandinavischen Literatur in Deutschland zu Ende – auch Mathilde Mann war davon betroffen. Am 20. Oktober 1914 schreibt sie in einem Brief an den Schriftsteller Sophus Bauditz, dass sie gerade acht Romane für die Herbstsaison übersetzt habe, als am 1. August der Krieg ausgebrochen sei, alles stillstehe, Verträge storniert würden und sie „lahmgelegt“ werde. Zum ersten Mal seit 29 Jahren habe sie Zeit. Sie blieb vorerst in ihrem Häuschen in Nymindegab in Dänemark, das sie als Sommersitz nutzte.
Mathilde Mann übersetzte weiterhin, aber hauptsächlich ältere Werke von Autoren, die in Deutschland bereits bekannt waren, wie Bjørnson, Strindberg, Jacobsen, Pontoppidan und Hamsun. 1921 bewarb sie sich um eine Stelle als Dänisch-Lektorin an der Universität Rostock und gab als Grund für ihre Rückkehr nach Deutschland „die Valuta-Verhältnisse“ an (Universitätsarchiv Rostock, 1.11.0 Personalakte Mathilde Mann). Es scheint plausibel, dass ihr das Leben in Dänemark zu teuer wurde, da ihre Honorare in deutscher Währung gezahlt wurden und die Inflation in Deutschland zu der Zeit bereits eingesetzt hatte. Sie bekam die angestrebte Anstellung als Dänisch-Lektorin. Sie wusste, dass sie zunächst kein Gehalt bekommen würde, hatte aber die Hoffnung, dass dies sich ändern würde. Von 1921 bis 1923 unterrichtete Mathilde Mann Dänische Sprache und Literatur an der Universität Rostock.
Ihre Personalakte im Archiv der Universität besteht vor allem aus Briefen und Dokumenten, die von ihrem bitteren Kampf um ihr Gehalt zeugen. Sie appelliert an die Universität und droht mit Kündigung. Sie argumentiert, dass ihre Übersetzungsarbeit darunter leide, dass sie wegen ihres Unterrichts weniger Zeit dafür habe, aber sie bleibt in Rostock, weil die Lehrtätigkeit ihr Befriedigung gibt, wie sie 1922 schreibt. Die Frage ist, ob sie – „mittellos“, wie es in ihrer Personalakte heißt – eine Alternative gehabt hätte. In Rostock konnte Mathilde Mann bei Verwandten ihres bereits 1910 verstorbenen Ex-Mannes wohnen und so Kosten sparen. Allerdings hatte sie gesundheitliche Probleme, weswegen sie ihre Lehrveranstaltungen für das Wintersemester 1923/24 absagen musste. Das mecklenburgische Ministerium für Unterricht bezahlte ihr einige dänische Bücher, das Abonnement der Zeitung Politiken sowie eine einmalige Wirtschaftsbeihilfe, ein wirkliches Gehalt für ihre Arbeit als Dänisch-Lektorin erhielt sie jedoch nie (Universitätsarchiv Rostock, 1.11.0 Personalakte Mathilde Mann).
Als eine Art Wiedergutmachung wurde ihr die Ehrendoktorwürde verliehen. Sie war die dritte Frau an der Rostocker Philosophischen Fakultät, die diesen Titel erhielt, und die erste, der er ausschließlich für ihre eigenen Leistungen verliehen wurde; die beiden vorigen Ehrendoktorinnen hatten ihre Ehemänner bei deren Forschungsvorhaben unterstützt. Mathilde Mann erhielt die Würdigung, da sie, wie es in der Urkunde heißt:
in selbstloser Hingabe lange Zeit hindurch den Interessen der philosophischen Fakultät und der Studentenschaft gedient und durch hervorragende Übersetzungen der nordischen, namentlich der dänischen Literatur die enge Verknüpfung des deutschen Geisteslebens mit dem nordischen gefördert hat.
Die Professoren der Philosophischen Fakultät sorgten für ein zügiges Verfahren. Als Mathilde Mann am 1. Dezember 1924 die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, war sie durch eine Krebserkrankung schon stark geschwächt. Am 14. Februar 1925, zehn Tage vor ihrem 66. Geburtstag, starb sie.
Übersetzungen
Mathilde Mann berichtet im Artikel in der Zeitung Politiken 1894, dass sie aus einem erzkonservativen Elternhaus stammte und keine „modernen“ Bücher lesen durfte. Deshalb war sie anfangs sehr erschrocken über die nordische Literatur und wählte die „unschuldigsten Dinge“ zum Übersetzen aus.
Sie scheint sich jedoch schnell an die modernen skandinavischen Bücher mit ihren gewagten und fortschrittlichen Themen gewöhnt zu haben. So übersetzte sie zum Beispiel mehrere Werke von Peter Nansen, der erotische Themen sehr liberal und offen behandelte. Sie muss seine Werke gemocht haben, denn sie setzte sich tatkräftig für sie ein und schaffte es, das Interesse des Verlegers Samuel Fischer vom S. Fischer-Verlag zu wecken. Sie kämpfte auch für den Roman Gertrude Colbjørnsen (1879) von Erik Skram, der sich ebenfalls mit Ehe und Sexualität beschäftigte, aber den Verlegern in Berlin zu „realistisch“ erschien und gekürzt werden sollte (Briefe an Erik Skram, 20. März 1889 – 11. April 1891). Erik Skram und Mathilde Mann gaben jedoch nicht nach, und schließlich wurde das Buch in voller Länge veröffentlicht – ein Triumph für Skram und seine Übersetzerin.
Die Übersetzung des Romans Forskrevet (Verschrieben,Leipzig 1892) von Holger Drachmann sei nach vier Monaten aus Berlin zurückgekommen, schreibt Mathilde Mann 1891 in einem Brief an den Schriftsteller: „Es ist den Herren zu ‚geistreich.‘ Sie wünschen sich Feuilleton – und Leihbibliothekenfutter!“ (Brief an Holger Drachmann, 28. März 1891) Offensichtlich bevorzugte Mathilde Mann „geistreiche“, realistische und moderne Literatur. Sie übersetzte viele Werke der skandinavischen Autoren der frühen Moderne, etwa Erik Skram, Holger Drachmann und auch Jens Peter Jacobsen. Ihre „sehr gelobte“ Übersetzung seines Romans Niels Lyhne war ihr persönlicher Durchbruch als Übersetzerin, erzählte sie 1894 in Politiken. Aber anders als der einflussreiche Literaturkritiker Georg Brandes, Herausgeber eines Buches über die wichtigsten zeitgenössischen männlichen Autoren Skandinaviens (Det Moderne Gjennembruds Mænd, 1883, dt. Die Männer des Modernen Durchbruchs), ignorierte sie die Autorinnen des Modernen Durchbruchs nicht.
Die Skandinavistin Annegret Heitmann verweist in ihrem Aufsatz über Skandinavische Schriftstellerinnen in Deutschland auf eine Bibliografie der Rezeptionsdokumente aus dem Zeitraum 1870–1914, aus der hervorgeht, dass „fast ein Viertel der damals in Deutschland gelesenen skandinavischen Schriftsteller Frauen waren“ (Heitmann 1997: 207). Laut einer digitalen literaturwissenschaftlichen Studie (Nielsen Degn et al. 2025: 5) wurden 20 % der Romane in diesem Zeitraum (1870-1914) von Frauen geschrieben. Mehr als ein Viertel der von Mathilde Mann übersetzten Werke stammen von Frauen, was ihr besonderes Interesse an Autorinnen bestätigt. Mathilde Mann übersetzte unter anderem Werke von Victoria Benedictsson, Amalie Skram, Anne Charlotte Leffler, Illa Christensen, Erna Juel-Hansen und Adda Ravnkilde, die sich mit Liebe, Sexualität und Ehe und Frauenrechten auseinandersetzten. Später übertrug sie mehrere Bücher von Karin Michaëlis ins Deutsche, darunter deren Skandalroman Den farlige Alder (Das gefährliche Alter, Berlin 1910) über die Wechseljahre und sexuellen Wünsche einer 40-jährigen Frau, der international Aufsehen erregte und in Deutschland zum größten Erfolg der Autorin wurde.
Mathilde Mann konnte es sich allerdings nicht leisten, ihre Aufträge rein nach ihren Interessen auszuwählen. So übersetzte sie neben der von ihr so geschätzten modernen Literatur auch spätromantische Unterhaltungsliteratur z. B. von Carit Etlar sowie zahlreiche Werke des dänischen Autors Sophus Bauditz, die in Deutschland sehr erfolgreich wurden. In den Übersetzungen Mathilde Manns spiegelt sich der Pluralismus der frühen Moderne: ästhetisch innovative Werke ebenso wie konservativ-reaktionäre, Trivialliteratur ebenso wie intellektuell anspruchsvolle.
Über Mathilde Manns Leistungen heißt es im Nachruf, den die Tageszeitung Politiken am Tag nach ihrem Tod im Februar 1925 veröffentlichte, dass sie mehr als 500 dänische Werke übersetzt habe und dass es ihr gelungen sei, das deutsche Publikum mit dem modernen dänischen Geist vertraut zu machen (Anon. in Politiken, 25. Februar 1925).
Ob Mathilde Mann wirklich 500 Werke übersetzt hat, lässt sich nicht nachprüfen, da es bislang noch keine vollständige Bibliografie gibt. Sie hat dem deutschen Publikum auf jeden Fall mindestens 100 dänische und etwa 40 schwedische und norwegische Werke sowie einige englische und französische Werke zugänglich gemacht. Außerdem geht aus der Korrespondenz mit Autorinnen und Autoren hervor, dass sie viele Theaterstücke und auch Erzählungen für Zeitungen und Zeitschriften ins Deutsche übertragen hat. Einige ihrer Übersetzungen wurden nie veröffentlicht, obwohl sie sich zum Teil jahrelang darum bemühte.
Karriere und Netzwerk
Die Zeitung Politiken war für Mathilde Mann unentbehrlich für den Aufbau ihrer Karriere. Wo immer sie lebte, hatte sie ein Abonnement. Hier kommt wieder Peter Nansen ins Spiel, der nicht nur Romane schrieb, sondern bis 1896 auch als Journalist für Politiken arbeitete, danach als Verlagsdirektor zum dänischen Verlag Gyldendal wechselte und für Mathilde Mann in all den Jahren einer ihrer bedeutendsten Kontakte war. Ihre Beziehung zu ihm kann als Beispiel für ihre Arbeitsweise dienen.
Wie bereits erwähnt übersetzte Mathilde Mann seine Romane und fand für sie einen deutschen Verlag. Sie war das Bindeglied zwischen Autor und Verlag, zwischen Dänemark und Deutschland. So handelte sie das Honorar für sich und Nansen aus und schickte die deutschen Rezensionen an ihn. Sie verhalf Nansen zum Erfolg in Deutschland, und im Gegenzug unterstützte er sie. Es gibt mehrere Briefstellen, in denen sie Peter Nansen bittet, eine Notiz über eine Übersetzung von ihr zu bringen, zum Beispiel im Brief vom 14. Februar 1894, und am 19. Februar 1894 findet man die Erwähnung in Politiken. Auf diese Weise schuf sie sich einen Namen als Vermittlerin dänischer Literatur in Deutschland. Dass sie dabei eine bewusste Strategie verfolgte, zeigt sich etwa in der folgenden Bitte, die sie an Nansen richtete, kurz nachdem sie 1894 nach Warnemünde umgezogen war:
Könnten Sie einen kleinen Hinweis in die Zeitung aufnehmen, dass ‚Niobe‘ in autorisierter Übersetzung von Frau MM an die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart verkauft worden ist? Könnten Sie eine kleine Notiz hinzufügen, dass seine (ich überlasse Ihnen das Epitheton ornans – sagen Sie nur nicht geschieden!) Übersetzerin jetzt in Warnemünde lebt und dass sie weiterhin an der Übersetzung skandinavischer Literatur arbeitet?“ (Brief an Peter Nansen,14. Februar1894). 2Dänischer Originaltext: „Vil De lade komme en lille Notiz i Bladet at ,Niobe’ er bleven solgt til Deutsche Verlags-Anstalt i Stuttgart i autoriseret Oversættelse af Fru M.M.? Kan De da tilføje en liden Notiz, at dens (Epitheton ornans overlader jeg til Dem – sig bare ikke fraskildte!) Oversætterske nu boer i Warnemünde og at hun stadig bliver ved med at overføre sk. Litteratur?“
Auch als Peter Nansen später bei Gyldendal arbeitete, profitierte Mathilde Mann davon, da er ihr immer wieder interessante Neuerscheinungen schickte und sie zum Beispiel mit dem dänischen Schriftsteller Gustav Wied bekannt machte, dessen Werke sie später übersetzte.
So wie sie eine persönliche Beziehung zu Peter Nansen pflegte, freundete sie sich auch mit anderen Autoren an, darunter Sophus Bauditz, Henrik Pontoppidan und nicht zuletzt Karin Michaëlis. Die Anbahnung und Pflege von Kontakten zum Zweck des beruflichen Fortkommens scheint sie hervorragend beherrscht zu haben.
Obwohl Mathilde Mann in fast jedem Brief an Peter Nansen und andere Autoren, mit denen sie ein Vertrauensverhältnis pflegte, ihre schwierige finanzielle Situation ansprach, begegnete sie Autoren und Verlegern auf Augenhöhe. Selbstvertrauen, sehr gute Sprachkenntnisse und Geschäftssinn verhalfen ihr, als Übersetzerin großes Ansehen zu erlangen. Sie legte sich kein männliches Pseudonym zu wie etwa die österreichischen Übersetzerinnen Marie Franzos oder Mathilde Prager, sondern arbeitete immer unter ihrem eigenen Namen.
Arbeitsprozess
Was wissen wir noch über ihren Arbeitsprozess? Aus dem Politiken-Artikel von 1894 sowie ihrer Korrespondenz geht hervor, dass sie, wenn sie in der Zeitung von einem neuen Buch las, den Autor oder die Autorin anschrieb und fragte, ob sich das Buch für eine deutsche Übersetzung eigne und sie die Rechte dafür bekommen könne. Oft musste sie sich das Buch vom Autor ausleihen, begann dann mit der Übersetzung und schickte entweder einen Auszug oder sogar das ganze Typoskript an einen Verlag. Wenn der erste Verleger kein Interesse zeigte, schickte sie es an den nächsten, bis sie einen Verleger fand, der das Buch herausbringen wollte. Dann handelte sie das Honorar für sich und die Autoren aus und schickte ihnen ihren jeweiligen Anteil. Das Korrektorat der Druckfahnen gehörte ebenfalls zu ihren Aufgaben, und nach Erscheinen des Buches schickte sie dem Autor ein Exemplar sowie die deutschen Pressestimmen. Dieser Arbeitsprozess war nicht unproblematisch. Erstens musste Mathilde Mann oft das ganze Buch übersetzen, um es deutschen Verlegern anbieten zu können, da diese die skandinavischen Sprachen nicht beherrschten. Wenn keiner das Buch verlegen wollte, war ihre ganze Arbeit umsonst. Wenn die Verleger zu lange brauchten, um sich zu entscheiden, riskierte Mathilde Mann, dass die Autoren das Buch von jemand anderem übersetzen ließen. Auch die Honorarverhandlungen waren mühsam. Der Verleger wollte so wenig wie möglich zahlen, da er nicht wusste, ob das Buch ein Erfolg werden würde. Der Autor wiederum wollte einen möglichst großen Anteil am Honorar. Überließ sie zu Beginn ihrer Karriere den meisten Autoren ein Drittel des Honorars, so war es später oft die Hälfte.3In einem Brief an den Schriftsteller Erik Skram vom 9. Dezember 1894 schreibt Mathilde Mann, sie habe am Anfang ihrer Karriere nur Jonas Lie und Bjørnstjerne Bjørnstjerne die Hälfte des Honorars gegeben, alle anderen Autoren hätten ein Drittel bekommen. Dagegen heißt es in einem Brief an den Autor Jakob Knudsen (Brief vom 4. Dezember 1913), dass auch andere Autoren die Hälfte bekommen hätten. All diese unbezahlte Arbeit mit den Verträgen, die heute von Literaturagenten und Verlagsmitarbeitern erledigt wird, scheint viel Zeit und auch Geld in Anspruch genommen zu haben.
Zusammenfassung
Mathilde Mann stammte aus einer bildungsbürgerlichen Familie, über die wenig bekannt ist, außer dass sie ihr sehr gute Sprachkenntnisse und Selbstvertrauen mit auf den Weg gab. Der Bankrott ihres Mannes machte es notwendig, dass sie durch das Übersetzen zum Lebensunterhalt beitrug. Später als alleinerziehende Mutter war sie gezwungen, alles zu übersetzen, was sich verkaufen ließ. Dass ihr Hauptinteresse der modernen Literatur galt, die Themen wie Frauenleben, Sexualität, Ehe, Scheidung usw. behandelte, geht aus ihrer Korrespondenz hervor.
Während ihrer fast vierzig Jahre währenden Tätigkeit als Übersetzerin hat Mathilde Mann zahlreiche bedeutende Werke ins Deutsche übertragen. Bereits zu ihren Lebzeiten erlangte sie große Bekanntheit, wurde in Dänemark mit einem renommierten Preis und in Deutschland mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Sie zählt auch aus heutiger Sicht zu den wichtigsten Vermittlerinnen skandinavischer Literatur im deutschsprachigen Raum.
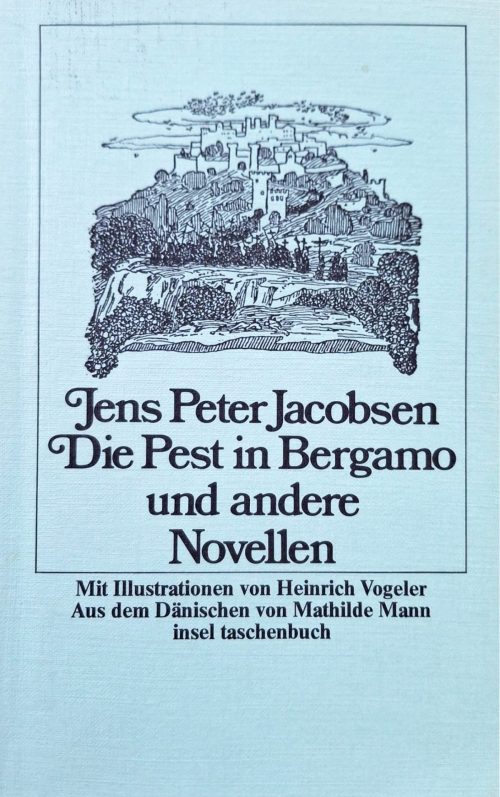
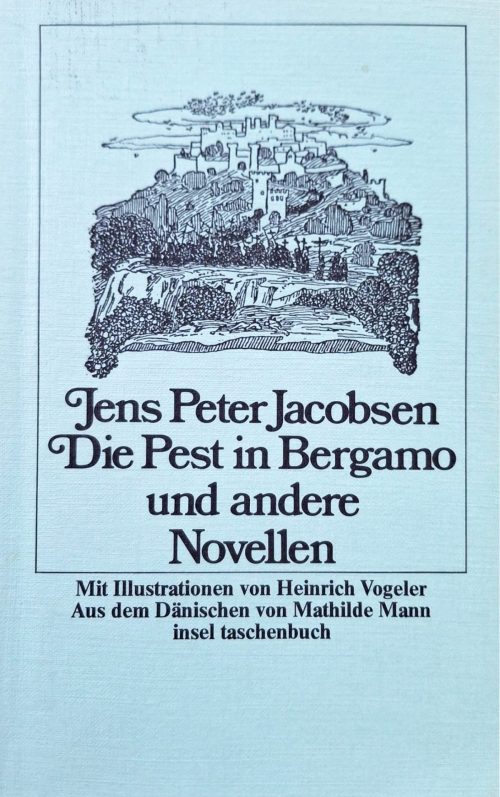
Anmerkungen
- 1Die Briefe von Mathilde Mann an Sophus Bauditz, Holger Drachmann, Peter Nansen, Amalie Skram und Erik Skram sowie die Briefe von Peter Egge, Jakob Knudsen, Karin Michaëlis und Henrik Pontoppidan an Mathilde Mann befinden sich in Det Kongelige Bibliotek (Die Königliche Bibliothek) in Kopenhagen.
- 2Dänischer Originaltext: „Vil De lade komme en lille Notiz i Bladet at ,Niobe’ er bleven solgt til Deutsche Verlags-Anstalt i Stuttgart i autoriseret Oversættelse af Fru M.M.? Kan De da tilføje en liden Notiz, at dens (Epitheton ornans overlader jeg til Dem – sig bare ikke fraskildte!) Oversætterske nu boer i Warnemünde og at hun stadig bliver ved med at overføre sk. Litteratur?“
- 3In einem Brief an den Schriftsteller Erik Skram vom 9. Dezember 1894 schreibt Mathilde Mann, sie habe am Anfang ihrer Karriere nur Jonas Lie und Bjørnstjerne Bjørnstjerne die Hälfte des Honorars gegeben, alle anderen Autoren hätten ein Drittel bekommen. Dagegen heißt es in einem Brief an den Autor Jakob Knudsen (Brief vom 4. Dezember 1913), dass auch andere Autoren die Hälfte bekommen hätten.