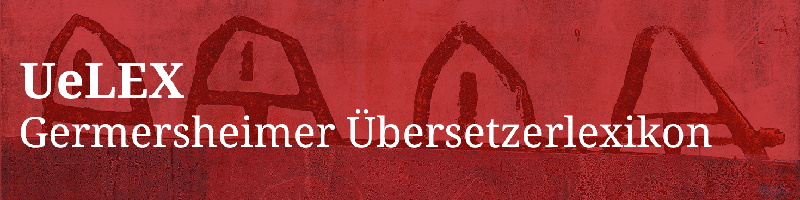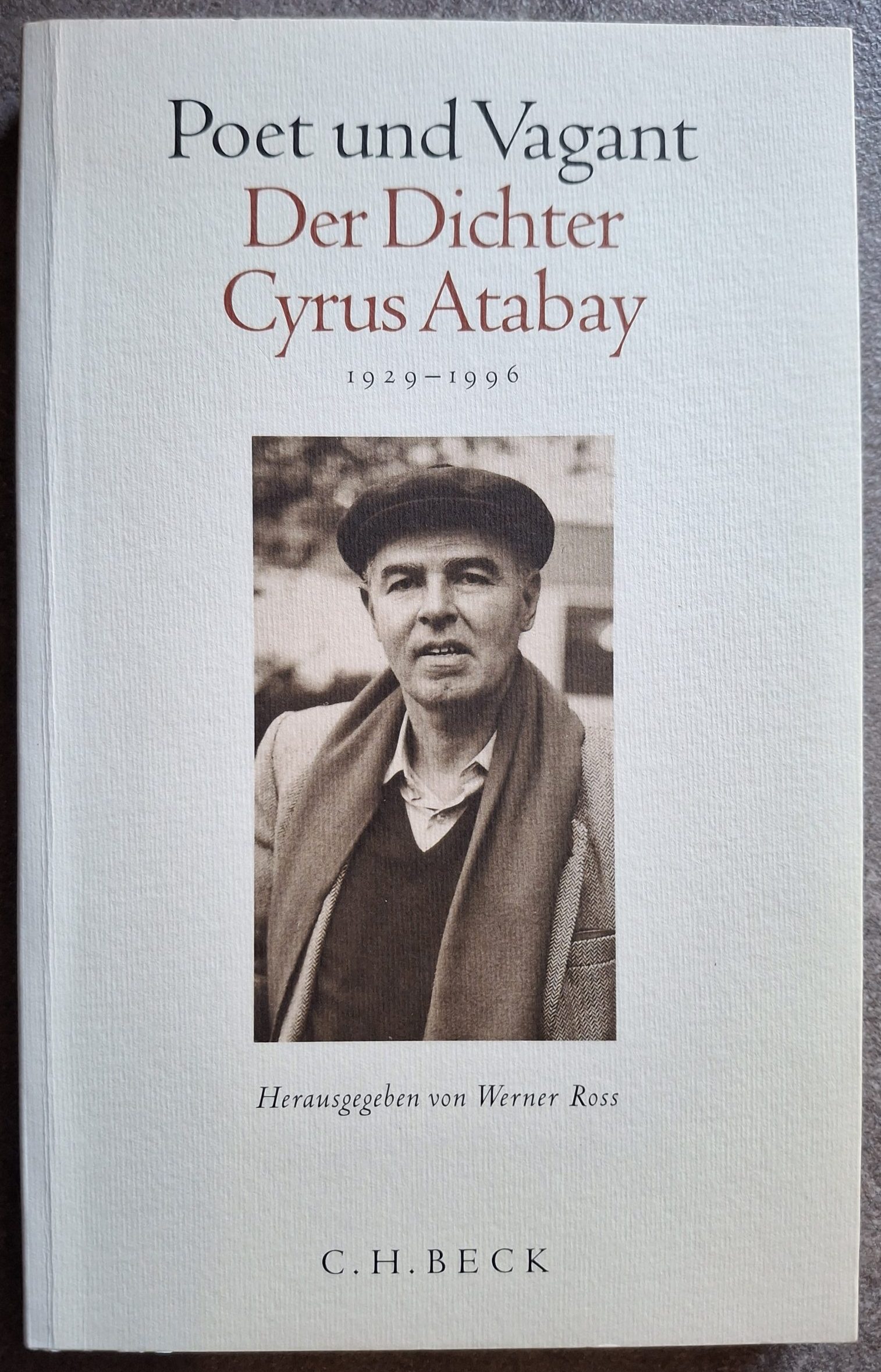Cyrus Atabay, 1929–1996
Cyrus Atabay, geboren am 6. September 1929 in Teheran, wurde von seinem Vater, der in den 1930er Jahren in Berlin Medizin studiert hatte, 1937 zum Schulbesuch nach Berlin geschickt.1Die biographischen Angaben folgen weitgehend Atabays autobiographischer Notiz anlässlich seiner Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung im Herbst 1993, erneut veröffentlicht 1997.Er besuchte das Arndt-Gymnasium in Dahlem und blieb bis zum Kriegsende in Deutschland. Im Sommer 1945 kam er zurück nach Persien, wo er seine Muttersprache erst wieder neu erlernen musste. Da sein Persisch für den Schulbesuch nicht ausreichte, wurde er auf eigenen Wunsch auf eine Schule in der Schweiz geschickt. In Zürich schrieb er in deutscher Sprache seine ersten Gedichte. 1952 begann er mit einem Germanistik-Studium in München. Erste eigene Gedichtbände erschienen in angesehenen Verlagen (Limes, Hanser).
Seit Anfang der 1960er Jahre lebte Atabay abwechselnd in Teheran und in London, wo er u. a. in Kontakt zu den Exilautoren Elias Canetti und Erich Fried kam. In Teheran gehörte er zu einem Kreis junger Schriftsteller, die seine Gedichte ins Persische brachten und mit deren Unterstützung er ihre Gedichte ins Deutsche übersetzte. So entstand die 1968 im Claassen Verlag veröffentlichte Anthologie Gesänge von Morgen. Neue iranische Lyrik.
Nach der iranischen Revolution von 1978 verließ Atabay Persien. In Großbritannien bekam er als nunmehr staatenloser Neffe von Schah Mohammad Reza Pahlavi politisches Asyl. 1983 siedelte er nach München über, wo er nach allerlei Hin und Her und Ernennung zum Ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste eine Aufenthaltserlaubnis erhielt (vgl. Reich-Ranicki 1982). 1990 wurde er mit dem Chamisso-Preis geehrt und 1993 in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen.
Seit 1981 erschienen seine Bücher vornehmlich in der Düsseldorfer Eremiten-Presse, mit deren Verlegern Friedolin Reske und Jens Olsson ihn eine langjährige Freundschaft verband (vgl. Olsson 1997). Insgesamt 14 bibliophil gestaltete Bücher hat Atabay in der Eremiten-Presse veröffentlicht, darunter sieben Bände mit Übersetzungen klassischer persischer Dichtung: Abul Ala Al-Ma’arri (10./11. Jh.), Omar Chajjam (11./12. Jh.), Rumi (13. Jh.), Hafis (14. Jh.) und Obeyd-e-Zakani (14. Jh.).
Die Übertragungen ergänzte Cyrus Atabay durch kluge, aufschlussreiche Nachworte, sodass ich ihn einmal scherzhaft einen poeta doctus, einen „gelehrten Poeten“ nannte. Aber das hörte er nicht gern. Er beanspruchte nichts anderes, als originärer Dichter zu sein. Seine Übertragungen, sein eindringliches Erschließen persischer Lyrik wollte er auf keinen Fall losgelöst von seiner eigenen Dichtung, sondern als deren Fortführung gedeutet wissen. (Horst 1997: 58)
Zum Wie seines Übersetzens hieß es im Juli 1995 in einem Brief an Friedolin Reske – mit Blick auf seinen Rumi-Band Ich sprach zur Nacht. Hundert Vierzeiler, der posthum 1996 zur Frankfurter Buchmesse erschien:
So viel ich weiss, wählte ich für die Übersetzung die einfachsten Wörter, die einfachste Diktion: nur keine Rhetorik, nur keine Lügen! (Zit. in Olsson 1997: 94)
Cyrus Atabay starb im Alter von 66 Jahren am 26. Januar 1996 in München, auf dem Nordfriedhof wurde er beigesetzt. Anderthalb Jahre später gab Werner Ross den Sammelband Poet und Vagant – Der Dichter Cyrus Atabay mit Aufsätzen von 22 Freunden und Weggefährten des „persischen Prinzen“ heraus. Das Thema Übersetzen wird leider in keinem der Beiträge gründlicher behandelt. Auch in den bald drei Jahrzehnten seither sind m. W. keine Studien zu seinen Übersetzungen erschienen. Auch um seine eigenen Gedichte haben sich Germanistik und Komparatistik bisher nicht großartig gekümmert (Ausnahmen: Masson 2002 und Chiellino 2016). Das mag an nicht vorhandenen Persisch-Kenntnissen liegen, ein Problem, auf das Christoph Meckel, der Atabay seit 1956 kannte, in seinen Merkmalminiaturen hinwies:
Kennt man einen Menschen, dem man nicht folgen kann in die andere Sprache? Man folgt ihm, mit gutem Willen und etwas Talent, in Ideologie oder Religion, in die Privatheit und in den Traum, in Beruf und Handwerk, Hoffnung, Sorge, weit hinaus in eine gemeinsame Sprache, aber nicht in eine, die man nicht kennt. „Die Auswirkung persischer Dichtung auf Atabay“, welcher Deutsche beurteilt das. (Meckel 1997: 76 f.)
Vielleicht werden sich eines Tages iranische Germanisten und Übersetzungsforscher in Teheran oder Isfahan mit den persisch-englisch-deutschen Verflechtungen im Leben und Werk Cyrus Atabays beschäftigen können.
Anmerkungen
- 1Die biographischen Angaben folgen weitgehend Atabays autobiographischer Notiz anlässlich seiner Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung im Herbst 1993, erneut veröffentlicht 1997.