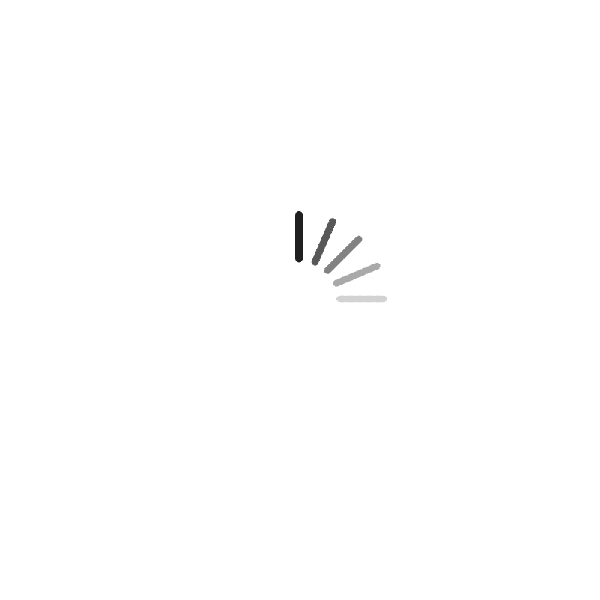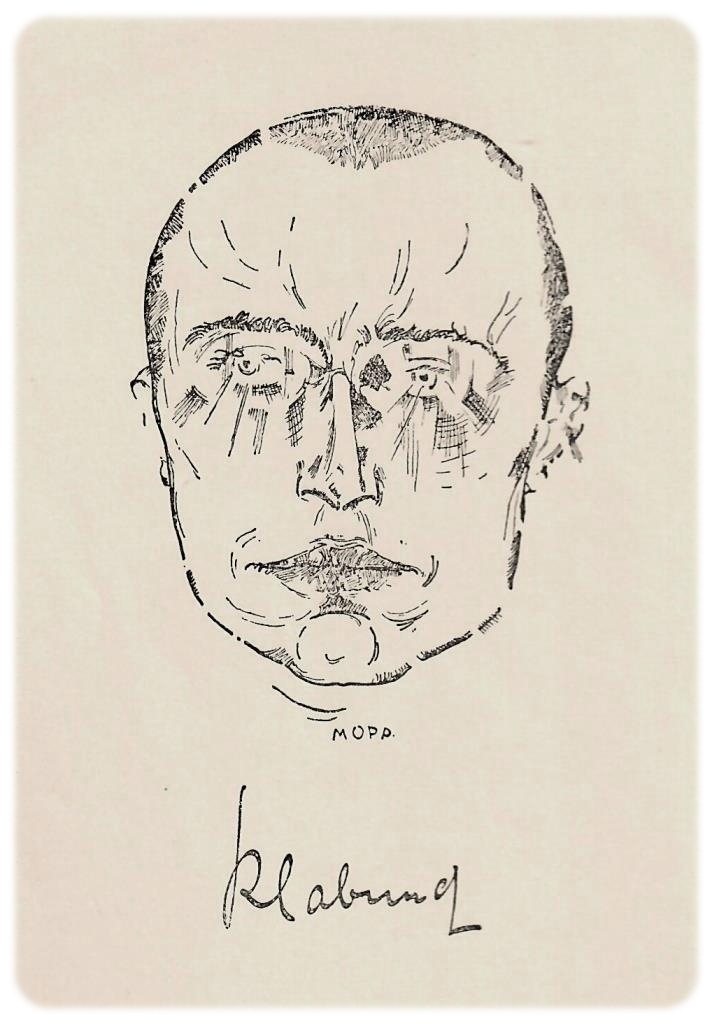Klabund, 1890–1928
Klabund, mit bürgerlichem Namen Alfred Henschke (1890–1928; der Künstlername setzt sich zusammen aus „Klabautermann“ und „Vagabund“), veröffentlichte von 1912 bis zu seinem frühen Tod 1928 nicht weniger als 76 Bücher: Gedichtbände, Romane, Dramen, Erzählungen sowie Übersetzungen bzw. Nachdichtungen orientalischer und fernöstlicher Lyrik und Schauspiele, ohne allerdings der jeweiligen Sprachen mächtig zu sein. Im „Dritten Reich“ wurden Klabunds Bücher als „Asphaltliteratur“ bzw. „entartete Kunst“ verboten. Bis heute populär sind seine Übertragungen klassischer chinesischer Lyrik, vor allem von Li Bai (Li Taibo, Li Tai-peh; 701–762).
Die für den kurzen Zeitraum ungeheure Kreativität Klabunds speiste sich aus dem durch eine frühe Tuberkulose-Erkrankung entstandenen Bewusstsein, keine Zeit zu haben. Das trieb ihn zwischen verschiedenen Kur- und Klinikaufenthalten zu intensivster schöpferischer Arbeit an. Nach dem 1909 glänzend bestandenen Abitur studierte der Apothekersohn aus Frankfurt an der Oder zunächst Chemie und Pharmazie, wandte sich jedoch bald der Philosophie, Philologie (Germanistik) und Theaterwissenschaft zu (in München und Lausanne). 1912 beendete er das Studium.
1913 folgten erste Veröffentlichungen in verschiedenen Zeitschriften (PAN, Jugend, Simplizissimus), 1914 wurde er Mitarbeiter der Schaubühne (später Weltbühne). Beim Ausbruch des Weltkriegs, den er zunächst enthusiastisch begrüßte, trafen seine Soldatenlieder den Ton der Zeit. Damals begegnete er chinesischer Lyrik in den sehr populären Übertragungen von Hans Bethge (Die chinesische Flöte, 1907), war sofort begeistert, aber auch sofort der Ansicht, dass dies anders ins Deutsche gebracht werden müsse.
Klabund hat anhand von deutschen, englischen und französischen Vorlagen chinesische, japanische und persische Texte nachgedichtet. Aber auch aus dem Französischen (Daudet) und Italienischen (Boccaccio) hat er übersetzt bzw. vorliegende Übersetzungen bearbeitet, in geringem Umfang auch polnische und ungarische Texte, vielleicht sogar russische. Die folgende Darstellung konzentriert sich auf Klabunds „orientalische“ Nachdichtungen, geordnet nach Sprachen und Gattungen.
Aus dem Chinesischen
1. Die Gedichte (1915/1921)
Die Nachdichtungen Klabunds aus dem Chinesischen basieren hauptsächlich auf den Prosaübersetzungen des Marquis Léon d’Hervey-Saint-Denys (1822–1892)1Poésies de l’époque des Thang (VIIe, VIIIe et IXe siècles de notre ère), traduites du chinois, avec une étude sur l’art poétique en Chine, 1862. Réédition partielle: Écoutez là-bas, sous les rayons de la lune, traduction de Li Bai et notes par le marquis d’Hervey Saint-Denis, révisées par Céline Pillon, 2004. Weitere Übersetzungen, auf die sich Klabund bezieht: Judith Gautier, Le livre de Jade, Paris 1867; Charles-Joseph de Harlez de Deulin, La poésie chinoise, Académie royale des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts, Bruxelles 1892. – Darüber hinaus hat Klabund seine Übertragungen u. a. von „gründlichen Kennern des Chinesischen“ wie dem Juristen und Privatgelehrten Hans Mortan (1864–1940), der unter dem Pseudonym Hans Rudelsberger Anfang des 20. Jahrhunderts Übersetzungen v. a. chinesischer Novellen veröffentlicht hat, durchsehen lassen (siehe Klabund 1928, zit. nach Klabund 2003: Bd. 8, 393)., seit 1874 Lehrstuhlinhaber für chinesische Sprache und Literatur am Collège de France.
Die Versuche Klabunds wurden begeistert rezipiert, aber auch von Anfang an kritisiert. Sein schärfster Kritiker war der Schriftsteller und Publizist Robert Neumann (1897–1975). Dieser polemisierte gegen die Übertragungen Klabunds (Neumann 1919) als ein „Gemenge aus Expressionismus, Schnoddrigkeit, und Exotik – bekömmlich für den literarischen Snob […]“ (ebd.: 79). Klabund sei zwar von tiefergehendem sinologischen „Wissen nicht beschwert“ (ebd.: 78), ihm sei aber bei „aller Verfälschung des Typischen […] eine gewisse schnoddrige Treffsicherheit und Präzision nicht abzusprechen“ (ebd.: 79). Ähnlich klingt in Neumanns Nachfolge E. P. Michalek in seinem mit „Tempelschändung“ überschriebenen Zeit-Artikel von 1952:
Klabund und Bethge hatten nur die Übersetzungen anderer vor sich; er trifft ebenso die phantasievolle Ungenauigkeit der Second-hand-„Übertrager“. Lyrisches Genie in Ehren, aber das Nachdichten „aus dem Geist heraus“ hat nur zu dem geführt, was kürzlich „Chinoiserien des 20. Jahrhunderts“ genannt wurde. Die Eindeutschungen Li T’ai-pos oder Po Chü-is mögen sehr poetisch sein, nur sind sie im allgemeinen gar nicht sehr chinesisch. (Michalek 1952)
Die Kritikpunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Erstens: Klabund übersetzt willkürlich, ungenau, fügt nach Belieben hinzu oder lässt aus – in translatorischen Begriffen: Er übersetzt sehr frei, illusionistisch, einbürgernd. Dieser Kritik liegt die unausgesprochene Annahme zugrunde, es wäre möglich, aus dem Chinesischen treu, antiillusionistisch und dokumentarisch zu übersetzen.
Zweitens: Klabund macht aus chinesischen Dichtern deutsche Dichter, ja Dichter des Expressionismus, „verfälscht das Typische“, schafft eine „stilisierte Verzerrung“ (Neumann 1919: 79). Dem liegt die unausgesprochene Annahme zugrunde, es wäre möglich, chinesische Dichtung in die deutsche Sprache zu übersetzen, ohne aus ihr deutsche Dichtung zu machen, d. h. es wäre möglich, einen Text zu übersetzen, ohne ihn in einer sprachlichen und/oder literarischen Epoche der jeweiligen Zielsprache zu verorten oder verorten zu müssen.
Drittens: Klabund übersetzt in exotistischen Chinoiserien, ohne dabei sehr chinesisch zu sein, weil ihm dazu das notwendige sprachliche und kulturelle Wissen fehlt. Dem liegen gleich mehrere unausgesprochene Annahmen zugrunde: Zunächst, es gäbe das Chinesische, es wäre in den Gedichten chinesischer Lyriker immer vorhanden, es lasse sich fassen und in einer fremden Sprache wie der deutschen als das darstellen, was es ist. Der Vorwurf des Exotismus und der Chinoiserie geht des Weiteren davon aus, es wäre möglich, das Fremde als Fremdes in einer Zielsprache aufscheinen zu lassen, ohne dabei an den Ort anzuknüpfen, der in den Konventionen der Zielsprache für das jeweilige Fremde vorgesehen ist, also ohne an das „Exotische“ anzuknüpfen. Anders gesagt: Es wäre möglich, das Chinesische im Deutschen sichtbar werden zu lassen, ohne an das anzuknüpfen, was dem Deutschen allgemein chinesisch vorkommt.
Es stellt sich die Frage, ob diese Kritikpunkte selbst einer kritischen Bestandsaufnahme standhalten. In seiner Antwort auf Neumann erteilt Klabund der dokumentarisch-verfremdenden Übersetzung aus dem Chinesischen eine allgemeine Absage:
„Wörtliche“ Übersetzung kann es bei der chinesischen Bilderschrift und einer der deutschen diametral entgegengesetzten chinesischen Grammatik überhaupt nicht geben. (Klabund 1928: 395)
Eine erstaunliche Erkenntnis, zumal für einen „Nicht-Fachmann“, der so ohne Kenntnis und Verständnis des Chinesischen nicht sein kann. Es wird noch weitere 27 Jahre dauern, bis diese Erkenntnis von sinologisch exponierter Stelle bestätigt wird. Herbert Franke schreibt 1955: „Hier, beim Chinesischen das Ideal der ‚Wörtlichkeit‘ aufzustellen, wäre kaum zu vertreten“ (Franke 1955: 140).
Das heißt aber nichts anderes, als dass die bis heute in der Übersetzungsforschung gängige Dialektik von wörtlicher/freier, antiillusionistischer/illusionistischer oder dokumentarischer/einbürgernder Übersetzung für das Chinesische nicht greift. Warum ist das so? Das Chinesische kennt keine Flexion und damit keine Zeitformen, kein Modus Verbi. Die syntaktische Funktion eines Wortes, häufig auch die Wortart, werden bestimmt durch die Stellung, das heißt die Funktion im Satz. Partikel und Konjunktionen verdeutlichen Beziehungen und zeigen Zeitverhältnisse an, Artikel fehlen, die Bildung von subjektlosen Sätzen ist möglich. Die Syntax ist parataktisch, nicht hypotaktisch wie im Deutschen, und: Vom Chinesischen her gesehen ist ein Infinitiv ebenso eine flektierte Form wie eine dritte Person Plural, woraus folgt, dass jede Übersetzung immer schon einbürgernd, also nicht dokumentarisch sein muss, selbst die Interlinear-Version.
Stellen wir zur weiteren Untersuchung ein aus dem sinologischen Umfeld stammende Übersetzung eines Gedichts von Li Bai der Version Klabunds gegenüber2Für eine ausführlichere Diskussion von zusätzlichen Beispielen siehe: Hans Peter Hoffmann: Klabunds Nachdichtungen chinesischer Lyrik – Tempelschändung oder Gegenübersetzung? In: Andreas F. Kelletat, Aleksey Tashinskiy und Julija Boguna (Hg.): Übersetzerforschung. Neue Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Übersetzens. Berlin: Frank & Timme 2016, S. 89–106.:
自遣 对酒不觉暝 落花盈我衣 醉起步溪月 鸟还人亦稀
ziqian (Aufmunterung) dui jiu bu jue ming luo hua ying wo yi zui qi bu xi yue niao huan ren yi xi
Selbsttröstung (Interlinear-Version) Gegenüber Wein/Alkohol nicht spüren Abend fallen/de Blüten füllen/voll mein Kleid betrunken aufstehen gehen Bach Mond Vögel zurückkehren Menschen auch selten
Selbstvergessen (Günther Debon) Vor mir der Wein. Ich spürte kaum das Nahn der Dunkelheit. Von niederfallendem Blütenflaum war mein Gewand beschneit. Da stand ich auf und stieg den Bach entlang in Trunkenheit. Der Mond… – kein Vogel war mehr wach; die Menschen waren weit.
Selbstvergessenheit (Klabund) Der Strom – floss, Der Mond vergoss, Der Mond vergaß sein Licht – und ich vergaß Mich selbst, als ich so saß Beim Weine. Die Vögel waren weit, das Leid war weit, und Menschen gab es keine.
Für die literarische Übersetzung gilt im Strukturalismus: Im Zweifelsfall ist die übergeordnete der untergeordneten Ebene vorzuziehen, d. h. es sind Veränderungen auf der untergeordneten Ebene akzeptabel, wenn dadurch die übergeordnete Ebene erhalten werden kann.
Die übergeordnete Ebene ist hier der chinesische Vierzeiler 绝句 (Jueju), die kürzeste feststehende Form in der chinesischen Lyrik, mit einem mehr oder weniger epigrammatischen Charakter. Das Jueju verlangt eine besondere Kürze der Darstellung und Einfachheit des Gedankens und fördert dabei eine symbolische Aufladung des Gesagten, um so im Kleinen das Große zu sehen (小中見大). Für eine solche Aufgabe sind Schriftzeichen und die Regeln der klassischen chinesischen Schriftsprache wie geschaffen, sie sind das ideale Medium für Lyrik. Es gilt: Eine Silbe = ein Wort = ein Schriftzeichen ist das kleinste Modul eines Textes und das dichterische Medium damit von einer in westlichen Sprachen unerreichbaren Flexibilität.
Die Übersetzung von Günter Debon kämpft mit dieser Knappheit der Aussage, die zu verdeutlichenden Hinzufügungen (kursiv) und Abweichungen (unterstrichen) zwingt. Klabund hingegen hat das übergeordnete Ganze, die Form als eigentliche Aussage im Kopf, das Gesagte soll nicht nur Mitteilung sein, sondern darüber hinaus in der Form erfahrbar Gestalt annehmen.3Hierauf weist bereits Ingrid Schuster in einem Aufsatz über Klabund hin: „Verglichen mit den anderen [sinologischen, H. P. H.] Versionen jedoch kommt Klabunds Nachdichtung dem Original weitaus am nächsten – in der Stimmung, der Aussage und, nicht zuletzt, in der Form“ (Schuster 2007: 21). Das ist das eigentlich Lyrische des Textes, das noch durch ein lautliches Geflecht (siehe Lautversion des Originals) von Reimen, Alliterationen, Anklängen und Silbenwiederholungen unterstützt wird. Die epigrammatische Schlusswirkung erreicht Klabund durch den umarmenden Reim „Weine – keine“, noch verstärkt durch die Punkt-Pause nach „Weine“.
Es fällt auf, dass Klabund das Inventar des Gedichtes, wenn auch verkürzend, beibehält, wobei allerdings ein Bild, eine Zeile völlig zu fehlen scheint: die fallenden Blüten, die das Kleid bedecken; dafür findet sich eine Zeile, deren Inventar frei erfunden scheint: das Leid war weit. Schauen wir uns Debons Übersetzung an, da lauten diese Zeilen:
Von niederfallendem Blütenflaum/ war mein Gewand beschneit.
Ein schönes Bild, aber ist dieses, zuletzt doch auch ein wenig verbrauchte, kitschig-süßliche Blütenflaum/Schnee-Bild geeignet, das im Übrigen so im Ausgangstext nicht steht, bei deutschen Lesern zu evozieren, was gemeint ist: Trauer über Vergänglichkeit und Sterben, die schon auf dem Höhepunkt der Blüte beginnen? Entgegen der Kritik heißt das für Klabunds Fassung: Sie verdeutlicht, und: Sie entkitscht, sie ent-exotisiert. Ohne Bild tritt das Leid auf, fast schon personifiziert und sehr behutsam evoziert durch sein Fehlen.
Die Übersetzungen nicht nur von klassischer chinesischer Lyrik, die im Allgemeinen sprachlich irgendwo zwischen westlicher Klassik und Romantik angesiedelt sind, zeigen, dass es unmöglich ist, eine Übersetzung sprachlich und literarisch nicht mehr oder weniger in einer Epoche der Zielsprache zu verorten; dies zu unterlassen, heißt, einen Text in ein allgemein ortloses Medium zu tauchen, das keine Wirkung, keine Kraft haben kann. Der Erfolg von Klabunds Übertragungen könnte aber gerade darauf zurückzuführen sein, dass er die alte chinesische Dichtung nicht in einen bereits vorliegenden und bekannten Sprachstil hüllt und künstliche Patina auflegt, sondern sie in seiner Zeit sprechen lässt.
Was aber macht Klabunds Nachdichtungen so „chinesisch“? Die bislang beste Studie hierzu kommt zu dem Schluss, Klabund habe nicht versucht, Inhalte adäquat wiederzugeben, sondern die spezifische Sageweise der chinesischen Sprache und den Charakter der (klassischen) chinesischen Lyrik mit ihrer Einsilbigkeit und ihrer „Prägnanz, lockeren Bindung, hohen Konzentration und großen syntaktische Freiheit“ (Jian 1990: 97). Doch dann überrascht Ming Jian mit einer erstaunlichen und paradoxen Feststellung:
Die meisten Nachdichtungen Klabunds entfernen sich weit von den chinesischen Originalgedichten. Dies besagt aber nicht, daß „das typisch Chinesische“ in diesen Nachdichtungen fehlt. Nur ist dieses „typisch Chinesische“ nicht immer das, was gerade diesem oder jenem chinesischen Originalgedicht innewohnt. (ebd.: 113, Herv. von H. P. H.)
Anders gesagt: Klabunds Versionen sind immer „typisch chinesisch“, auch dort, wo die chinesischen Ausgangstexte es nicht sind. Über Ming Jian hinaus stellt sich die Frage: Wie ist dieses Paradox zu erklären?
Wie bereits erwähnt, ist die klassische chinesische Schriftsprache in ihrer Syntax parataktisch. Diese Parataxe der Sprache wollte Klabund als typische Eigenheit des Chinesischen nachahmen, hat dabei aber außer Acht gelassen, dass auch parataktische Sprachen syntaktisch vollständige Sätze bilden. Innerhalb dieser parataktisch-vollständigen Sätze gab es aber für chinesische Dichter immer die Möglichkeit, Bilder – wir würden heute sagen: imagistisch – unverbunden einander gegenüberzustellen. Das verkennen Klabund und mit ihm seine Kritiker: Das Parataktische in der chinesischen Lyrik ist nicht Sprache, sondern: Stil. Daher sind seine Übersetzungen auch dort „typisch chinesisch“, wo es der Ausgangstext nicht ist. Denn seit Ezra Pounds Imagismus, der sein typisch parataktisch-unverbundenes Gegenüber von Images an entsprechenden Stilformen der klassischen chinesischen Dichtung und der japanischen Haiku-Dichtung schulte, gilt diese im Westen „moderne“ Stilform in einem fruchtbaren Missverständnis als „typisch chinesisch“. Sie repräsentiert aber nicht den „Geist“ der chinesischen oder japanischen Dichtung insgesamt, sondern den Geist einer bestimmten Stilrichtung, die aus westlicher Sicht als das Chinesische schlechthin rezipiert wurde und wird.
Wie aber ist ein nachdichtendes, in Anlehnung an zeitgenössische Strömungen den „Geist“ eines Textes und die zeitliche Distanz auch gegen den Ausgangstext selbst behauptendes Übersetzen zu verstehen? Wenn Klabund etwa in den Übertragungen chinesischer Kriegsgedichte die Beschreibung des Elends durchgehend verschärft und vertieft, tritt er bewusst mit dem Ausgangstext in einen Dialog. Die Unterschiede der jeweiligen historischen Situation von Ausgangs- und Zieltext, Autor und Übersetzer werden an inhaltlichen Differenzen sichtbar: etwa zwischen dem Krieg zur Zeit der Tang-Dynastie und der technisierten Kriegsführung des ersten Weltkriegs, die den anfangs begeisterten Kriegsanhänger nach wenigen Monaten zu einem scharfen Kriegsgegner macht. Was dadurch entsteht, ist im weitesten Sinn eine „Gegenübersetzung“, wie sie Paul Celan bei seinen Übersetzungen der französischen Symbolisten eine Zeit lang angestrebt hat (s. hierzu Harbusch 2005, Pennone-Autze 2007):
Zunächst muss die Beziehung, die Celan zu jedem übersetzten Autor und jedem Text aufbaut, als ein einmaliges und individuelles dialogisches Verhältnis betrachtet werden: als die Begegnung eines Dichters mit einem anderen Dichter und einer Poetik mit einer anderen Poetik. Die Übersetzung ist Ort dieser Begegnung, in ihr zeichnen sich die Spannungen, gegebenenfalls die Konflikte ab, die die Beziehung des Übersetzers zur Poetik des Originals prägen. Abweichungen dienen dem Übersetzer daher als Mittel einer Distanznahme, mit denen er der Poetik des Ausgangstextes seine eigene gegenüberstellt. Solche Gegenüber-Setzung wird aber in manchen Fällen zu einer Gegen-Übersetzung. (Pennone-Autze 2007: 4)4Die Begriffe Gegen-Übersetzung und Gegenüber-Setzung stammen von Ute Harbusch.
Gegenüber-Setzung und Gegen-Übersetzung auch dort, wo Klabund bewusst und erkennbar chinesische Originale der modernen Dichtungssprache seiner Zeit gegen-über-setzt – nicht als falsch verstandene Einbürgerung oder Anbiederung an ein imaginäres Publikum, sondern als bewusste und konsequente Gestaltung einer Aporie.
2. Das Drama: Der Kreidekreis (1925)
Das Drama Der Kreidekreis, das Klabund 1925 mit großem Erfolg auf die Bühne brachte, das zum meistgespielten Drama der Weimarer Republik avancierte und Bertolt Brecht zu seinem Kaukasischen Kreidekreis inspirierte, kannte er durch die Übersetzungen des französischen Sinologen Stanislas Julien (1797–1873) aus dem Jahr 1832 und die deutsche Übersetzung von Anton Eduard Wollheim da Fonseca (1810–1884) aus dem Jahr 1876:
Er betrachtete die Originalfassung als reinen Rohstoff, als eine „ziemlich lederne, hölzerne Angelegenheit“. Denn für ihn ist der chinesische Kreidekreis nur ein Gerichts- und Sittendrama […], das er ohnehin uninteressant fand. Er wollte daraus ein „chinesisches Märchenspiel“ schaffen, „wie wenn jemand von China träumt.“ (Hsia 1977: 134, Zitate von Klabund aus: Klabund 1927: 7)
Wie Hühnerfeld in einem Zeit-Artikel bemerkt, lässt Klabund die Hauptfigur, das Mädchen Haitang, die er erstaunlicherweise „als zu chinesisch“ empfand,
in seinem Kreidekreis die Entwicklung von einem Mädchen, das mit gewisser Freude ins Teehaus geht, zur Heiligen durchmachen […]. Die einfache, metaphysisch anmutende Konzeption des chinesischen Stückes wird dadurch zugunsten einer balladesk-amüsanten, verwirrenden Handlung verdrängt, die nicht mehr mit China zu tun hat, als die geschnitzten Pagoden, die sich am Ende des 18. Jahrhunderts wohlhabende Bürger in den Garten – oder ins „Teehaus“ stellten. Eine Vergröberung ist die Umzeichnung mehrerer Figuren: aus dem armen Dichter Liu Po wird der Kaisersohn Pao und aus dem leichtlebigen Studenten Tschang Lin gar ein Sozialrevolutionär Brechtscher Prägung, der vor Gericht seinem Kaiser tüchtig die Leviten liest: „Wir Armen werden unter seinem Banner/ Rechtlos am Straßenrand verrecken wie bisher./ Denn Recht hat nur, wer Macht hat, Geld, ein Amt …“ Wörtlich übernimmt Klabund nur die Gerichtsszenen, weil ihnen schon im Urtext etwas Groteskes anhaftet. (Hühnerfeld 1953)5Ausführliche Darstellungen zu den dramaturgischen Eingriffen Klabunds in die Vorgaben des Originaltextes finden sich in: Hsia (1977) und Forke (1927).
Diese Veränderungen sind in keiner Weise übersetzungstheoretisch oder -praktisch motiviert, sie folgen allein und, so Hühnerfeld, zurecht dramaturgisch-zeitbezogenen Gesichtspunkten:
Dennoch war Klabunds Erfolg nicht unverdient. Ein Schriftsteller, der so auf der dünnen Grenzlinie zwischen Dichter und gutem Handwerker balancierte, wie Klabund (wobei er oft das Dichterische, fast immer aber das Gut-Handwerkliche erreichte) ist seiner Zeit und dem Theater seiner Zeit unterworfen. Das Theater der zwanziger Jahre war ein höchst kompliziertes, durch den Expressionismus explosives und doch auf großen Traditionen beruhendes Theater. Letzte psychologische Feinheiten in der Charakterführung, schlichter Naturalismus, der in Romantik umschlug, chaotische Schreie, die Verlorengegangenes wiederbeschwören wollten – das alles spielte sich auf der Bühne ab. Das Theater erreichte damals die höchste Intellektualität, die es in Europa vielleicht je hatte. […]
Klabund tat recht, als er den Kreidekreis in schöner Sprache umdichtete. Denn dem alten chinesischen Stück haftet jene Simplizität und Frömmigkeit an, die damals vielleicht nicht verstanden worden wäre. (ebd.)
Was Klabund auf die Bühne bringt, ist weder Übersetzung noch Nachdichtung, sondern eine in vielen Teilen vom Original abweichende dramaturgische Bearbeitung des Ausgangsstoffes, die ihre Stärken und Schwächen haben mag. In Bezug auf Klabunds Fassung jedoch übersetzungskritische Kategorien anzuwenden und, wie Alfred Forke in der Einleitung zu seiner eigenen Übersetzung des Kreidekreises, von einer freien „Nachdichtung“ zu sprechen (Forke 1927: 7), erscheint mir nicht sinnvoll.
3. Die Philosophie: Mensch, werde wesentlich! Laotse – Sprüche, deutsch von Klabund (1921)
Der Titel führt in die Irre, denn auch hier hat Klabund nicht übersetzt im eigentlichen Sinn. 1921 lagen bereits eine Reihe von Laozi-Übersetzungen vor, allen voran die bei Diederichs 1919 erschienene Übersetzung von Richard Wilhelm. Dass Klabund vor allem die Übersetzung von Wilhelm benutzt, zeigt sich neben einer großen Anzahl von Übereinstimmungen in Wortwahl und Formulierung vor allem in der Übernahme der Übersetzung von dao mit Sinn. Texte, in denen die Übersetzung de – Leben vorkommt, hat Klabund nicht ausgewählt.
Von den 81 Sprüchen des Daodejing hat Klabund mit 26 ein gutes Drittel in einer eigenen Fassung vorgelegt. Neben einer eigenwilligen, altertümlichen Schreibweise der Texte im Blocksatz, in dem Zeilenbrüche durch Schrägstriche angezeigt werden und die jeweils erste Zeile durch Großschreibung herausgestellt, aber doch nicht zum Titel gemacht wird, erwecken Klabunds Texte den Eindruck von Spalten, etwa so wie in der zweispaltigen Aufteilung einer traditionellen Bibelausgabe:
INS LEBEN TRETEN HEISST IN den Tod eingehn / dreizehn Helfer helfen dem Tod / der Mensch wird gelebt anstatt daß er erlebt / so findet der Tod dreizehn verwundbare Stellen an ihm / woher das? / weil ihm sein Leben Völlerei ist / wir hören: wer zu leben weiß der schreitet durch die Lande ohne Furcht vor Tiger und Nashorn / er schreitet zwischen Lanzen und Dolchen der feindlichen Heerscharen hindurch ohne Panzer und Waffen / das Nashorn findet keine Stelle an ihm sein Horn einzubohren / der Tiger findet keine Stelle seine Tatzen hineinzuschlagen / der Dolch kann nirgends seine Spitze in ihn senken / warum dies? / weil er unsterblich ist.
Klabunds Verfahren, bei dem er sich nicht vergewissern kann, welche der verwendeten Übersetzungen nun richtig ist, birgt natürlich große Gefahren. So wird hier eine falsche Übersetzung in Kapitel 50, vermutlich aus der Laozi-Übersetzung (1870) von Victor von Strauß oder von Suzuki (Strauß 2004: 123)6Die Übersetzung von Suzuki und Carus (1913) unterstützt auch diese Lesung, während Legge (1891) und Goddard (1919) die gleiche Übersetzung wie Wilhelm liefern, die auch die heutige Standardübersetzung ist. Zu einer vergleichenden Nebeneinanderstellung der letzten drei genannten Fassungen, siehe: ‹https://www.yellowbridge.com/onlinelit/daodejing.php› (9. Juli 2018). übernommen und somit der Sinn mystifiziert: Es ist nicht von dreizehn Helfern, dreizehn verwundbaren Stellen die Rede (zudem ist im Chinesischen die 13 keine besondere Zahl und bringt auch kein Unglück!). Gemeint ist, wie es Wilhelm richtig übersetzt, dass „drei unter zehn“ oder drei von zehn in der Lage sind „Gesellen des Lebens“, „des Todes“ zu sein und „Menschen, die leben/ und sich dabei auf den Ort des Todes zubewegen,/ gibt es auch drei unter zehn“ (Wilhelm 1978: 93).
Hin und wieder finden sich Sätze, die Klabund aus nicht ersichtlichem Grund hinzufügt, wie im obigen Beispiel: „der Mensch wird gelebt anstatt daß er erlebt“ – eine Hinzufügung, die von keiner jener Übersetzungen, die auch Klabund zugänglich gewesen sein könnten, motiviert ist und natürlich so auch im Original nicht zu finden ist. Solche Hinzufügungen sind aber durchweg aus dem Geist des Laozi-Verständnisses zu begreifen, wie es Klabund im Kontext seiner Daodejing-Adaptionen formuliert hat:
Das östliche Denken, wie Laotse es denkt, ist ein mythisches, ein magisches Denken, ein Denken an sich: das westliche Denken ist ein rationalistisches, empiristisches Denken, ein Denken um sich, ein Denken zum Zweck. Der östliche Mensch beruht in sich und hat seinen Sinn nur in sich. Seine Welt ist eine Innenwelt. Der westliche Mensch ist „außer sich“. Seine Welt ist die Außenwelt. Der östliche Mensch schafft die Welt, der westliche definiert sie, der westliche ist der Wissenschaftler. Der östliche ist der Weise, der Helle, der Heilige, der Wesentliche. (Klabund 2001: 169)
Sein Laozi-Verständnis macht hierbei den häufig begangenen Fehler, das, was dem Westen besonders „chinesisch“ vorkommt, gleich auf den östlichen Menschen in toto zu übertragen. Der Daoismus war und ist aber in der realen chinesischen Gesellschaft nicht die dominierende und tonangebende Haltung, sie ist im Gegenteil immer auch als Kritik an der herrschenden Doktrin von Konfuzianismus und Legismus zu verstehen und somit eher Wunsch als Wirklichkeit.
Insgesamt ist Klabund bemüht, seinen Laozi-Sprüchen eine gewisse Direktheit und Unmittelbarkeit der Sprache mitzugeben, die schon bei seinen Li Bai-Dichtungen zu erkennen war, wobei allerdings wichtige Hauptbegriffe wie Dao/Tao verschwinden können. Im Gegensatz zu den Übertragungen der Tang- und Songgedichte und auch der dramaturgischen Bearbeitung eines Stoffes für das Theater der Weimarer Republik stößt das Nachdichtungsverfahren Klabunds im Bereich der Philosophie an seine Grenzen. Wo dort Gegenübersetzung und dramaturgische Anpassung einen Mehrwert erzeugen, ist das im Falle von Laozi kaum der Fall. Auch wenn die Sprüche des Daodejing ursprünglich gereimt waren,7Eine entsprechend gestaltete Übersetzung hat Günter Debon vorgelegt: Lao-tse – Tao-Tê-King, Das heilige Buch vom Weg und von der Tugend. Stuttgart: Reclam 1961 (RUB Bd. 6798). auch wenn Klabund hier und da eine Unmittelbarkeit und Frische gelingt, die anderen Fassungen fehlen, so fallen hier, wo es nicht auf dichterische Stimmung und theatralische Wirkung ankommt, sondern auf präzise Aussage und Wiedergabe, Ungenauigkeiten oder Missverständnisse sehr viel stärker ins Gewicht.
4. Das Buch der irdischen Mühe und des himmlischen Lohnes (1921)
Das太上感应篇taìshàng gǎnyìng piān, wörtlich etwa: „Antworten des Erhabenen Lehrers“, ist ein dem sog. Religiösen Daoismus zugeordneter Text, der ursprünglich der Essaysammlung 抱朴子bàopŭzĭ von 葛洪 Ge Hong (283–343) zugerechnet wird. Während der Song-Dynastie soll das Werk dann u. a. von 李昌龄 Li Changling (937–1008) weiter verbreitet worden sein. Im Vorwort heißt es:
Die „Antworten des Erhabenen Lehrers“ ist ein ausgesprochen wichtiges Buch, das als „das beste Buch aller Zeiten“ angesehen wird. Der Herausgeber ist Li Changlin, über die Dynastien hinweg sind viele Druckfassungen überliefert, deren Anzahl in der Ming- und Qing-Dynastie einen Höhepunkt erreicht. […] Im Buch verschmelzen eine ganze Reihe von traditionellen Volksweisheiten, mit denen das korrekte Bild des Menschen in der Welt etabliert wird; Vieles ist bis heute noch von positiver Bedeutung.8Online unter: ‹http://www.xuefo.net/nr/article33/334181.html› (12. Juli 2018). (Übers. von H. P. H.)
Die 1921 erschienene deutsche Erstübersetzung von Klabund (s. Klabund 2001: 173) basiert nach eigenen Angaben auf der Fassung von Abel Rémusat: Le livre de récompenses et des peines (Paris 1816).9Der Text der französischen Übersetzung ist zu finden unter: ‹https://www.chineancienne.fr/traductions/le-livre-des-récompenses-et-des-peines-trad-abel-rémusat/› (12. Juli 2018). Beiden gemeinsam ist eine falsche Übersetzung des Begriffes 太上 taìshàng, der im Titel verwendet wird und auch im folgenden Text vorkommt. Rèmusat übersetzt diese Ehrenbezeichnung für einen daoistischen Lehrer oder Meister mit „sublime doctrine“ und Klabund noch weiter interpretierend und im Sinne seines Chinaverständnisses mit „die tiefste Innerlichkeit“. Im Großen und Ganzen hält sich Klabund eng an die französische Vorlage, löst jedoch die Abschnitte nach ihren Sätzen bzw. Sinneinheiten in Zeilen auf, was der großen Regelmäßigkeit des Originaltextes, der sich fast durchgehend in Einheiten aus jeweils vier Schriftzeichen strukturiert, zumindest ein wenig Sichtbarkeit verschafft. Allerdings werden auch im Chinesischen die Vierer-Ketten zu verschiedenen Sinn-Abschnitten zusammengefasst, was bei Klabund verloren geht:
Die Originalstelle erscheint im Chinesischen und Französischen vom „Format“ her gleich:
故吉人语善、视善、行善,一日有三善,三年天必降之福。凶人语恶、视恶、行恶,一日有三恶,三年天必降之祸,胡不勉而行之? Aussi l'homme véritablement heureux dit le bien, voit le bien, fait le bien. En un jour il réunit trois sortes de biens. En trois ans le Ciel lui envoie infailliblement le bonheur. Le méchant dit le mal, voit le mal, fait le mal. En un jour il amasse trois sortes de maux, et en trois ans, le Ciel ne manque jamais de lui envoyer le malheur. Comment peut-on donc ne pas pratiquer la vertu?
Klabund zeigt die innere, spruchhaft-poetische Struktur, die durch den leicht von der Hand gehenden Reim „sagt/wagt“ noch weiter betont wird:
Also der wahrhaft gute Mensch: sagt das Gute, sieht das Gute, wagt das Gute. An einem Tag vereint er die drei Arten des Guten. In drei Jahren sendet ihm der Himmel unfehlbar die Glückseligkeit. Das Böse aber sagt das Böse, sieht das Böse, wagt das Böse. An einem Tage häuft er alle Arten des Bösen. Und in drei Jahren wird der Himmel nicht ver- fehlen, ihm unfehlbar das Unglück zu senden. Wie also sollte nicht ein jeder bedacht sein, die Tugend zu tun? (Klabund 2001: 185)
Aus dem Japanischen
1. Die Lyrik: Die Geisha O-sen. Geisha-Lieder (1918)
Der Untertitel zu diesem Titel lautet bei Klabund: „Nach japanischen Motiven“. Wenn Klabund, der, wie bisher gezeigt, Begriffe und Bezeichnungen durchaus mit Bewusstsein und Überlegung wählt, selbst nicht von Nachdichtungen spricht (wie etwa aus dem Chinesischen oder Persischen), so ist hier davon auszugehen, dass es sich bei diesen Texten um freie Eigenschöpfungen handelt, die sich nur motivisch an ein Themengebiet, nämlich das der Geisha anlehnen. Direkte Bezüge zu japanischen Texten sind nicht möglich. Deshalb hier nur einige wenige Einschätzungen zu diesen Texten. Klabund sagt selbst zur Person der Geisha O-sen:
Die Lieder der Geisha O-sen, wie sie hier geboten werden, sind ohne Kommentar verständlich. Vielleicht sind einige Bemerkungen trotzdem nicht unwillkommen. Die Geisha O-sen lebte im achtzehnten Jahrhundert, etwa von 1745 bis 1780. Sie war in einem Teehause der Stadt Kasamor (bei Higurashi) angestellt und wegen ihrer bezwingenden Schönheit weit im Lande berühmt. Sie hatte viele Liebhaber, darunter den Schauspieler Kikunojo, den hübschen, in Veddo sehr populären Straßenhändler mit Zuckerwaren: Dohei, und vor allem den Meister der Holzschnittkunst Suzuki Harunobu, der sie oft als Modell benutzte. Wegen ihrer außergewöhnlichen Schönheit wurden die Puppen beim Buddafeste zu Jida nach ihrem Bilde verfertigt.
Die wenigen Autoren, die sich zu Klabunds Geisha-Liedern geäußert haben, konzentrieren sich hauptsächlich auf Fragen des Exotismus:
Wenn […] Klabund in seinen Geisha-Liedern (1918) der Hauptfigur eine innere Stimme verleiht, indem er sie aus der Ich-Perspektive sprechen lässt, dann werden poetische Formen und ästhetische Wahrnehmungsweisen einer fremden Kultur in eigene Schemata übertragen. Die Diversität wird unter diesen Umständen mehr oder weniger ausgelöscht. Das ist im besonderen Maße bei Klabunds Ich-Perspektivierung der Fall, bei der die begehrliche und aus westlicher Sicht undurchschaubare Erscheinung der Geisha in die westliche Imagination des Exotisch-Erotischen eingeschlossen und gewissermaßen „reterritorialisiert“ [vgl. Deleuze/Guattari 1992: 703ff.] wird.
[…]
Die Geisha-Lieder provozierten umgehend einen Eklat mit den damaligen Fachexperten (darunter Fritz Loewenstein und Julius Kurth), allein schon deshalb, weil der Dichter den damals üblichen Fehler beging, die Geisha mit einem Teehausmädchen zu verwechseln bzw. beide gleichzusetzen, wie dies vorher schon in der seinerzeit gefeierten Operette Die Geisha von Owen Hall (1896) geschehen war. Mit der Geisha verband sich nicht nur in Deutschland immer wieder die Frage, ob sie „eine hochstehende Kulturträgerin oder aber eine moralisch verworfene Prostituierte sei“ – oder eben beides zugleich, „also eine sich vielleicht zuweilen auch prostituierende Kulturträgerin“ (Thomas Pekar […]). Es war besonders die Undurchschaubarkeit und Ambivalenz dieser Frauenfigur, für die es kein Pendant in der westlichen Kultur gibt […]. (Klawitter 2015: 437)
Andreas Wittbrodt sieht in den Geisha-Liedern ein Paradebeispiel der „Literatur des Exotismus bzw. des Japonismus“ und in der „Umdeutung“ der Geisha „zur Prostituierten in der ersten Strophe des Einleitungsgedichts“ ein „Paradebeispiel für eine Ansammlung von Klischees“:
Ach ich arme kleine Geisha – Tausend Männer muß ich lieben, Und nur einer ist geblieben mir im Herzen. (Wittbrodt 2005: 18)
Keiner der Autoren allerdings widmet sich den Liedern selbst, deren expressionistisch-exotisch-erotisches Flair als „Kompensationsstrategie“ (ebd.: 125), als „Flucht in ein idealisiert-ästhetisches ‚Reich der Sinne‘“ angesehen wird, mit dem „dem Frustrationserlebnis der Entfremdung“ (Reif 1975: 12) während des ersten Weltkriegs begegnet wurde. Die Geisha-Lieder haben den gleichen bänkelsängerischen Ton, der für Klabunds Dichtung so typisch ist, sie sind im Erotischen wagemutig, ein Wagemut, der seinerzeit sehr häufig den Umweg über das Fremd-Exotische nehmen musste, um überhaupt gesellschaftsfähig zu werden. Vor allem fallen hier Gedichte auf, die mit zwar gereimten, aber prosahaften Langzeilen einen Ton anschlagen, der mit Exotismus allein nicht mehr zu beschreiben ist:
Eine Pfirse Steht am Weg in rosavioletter Blüte. Rings die Felder sind wie Hirse- brei. Der Tempelturm am Horizont wie eine aufgestülpte Tüte. […]
2. Das Drama: Das Kirschblütenfest. Spiel nach dem Japanischen (1927)
1927, zwei Jahre nach dem Kreidekreis versuchte sich Klabund erneut an einer Dramenbearbeitung, diesmal an dem japanischen Drama Terakoya von Takeda Izumo (1691–1756), und nannte es Das Kirschblütenfest:
Ob er durch Weingartners Oper auf das Stück aufmerksam wurde, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Der Textvergleich zeigt, daß er sowohl Gersdorffs Fassung wie die Übersetzung von Florenz kannte und verwertete. Gersdorffs Terakoya, ursprünglich nur als Bühnentext publiziert, war 1926 in dem Sammelband Japanische Dramen – Für die deutsche Bühne bearbeitet erschienen. (Schuster 2007: 66)
Klabund lag allerdings erneut nichts ferner als ein „japanisches Drama deutschen Zuschauern nahezubringen“ (ebd.), zumal das Verständnis des Originalstückes nicht leicht fällt:
Zweierlei erschwert dem westlichen Zuschauer das Verständnis dieses Stückes. Erstens kennt er die Vorgeschichte von Terakoya nicht, die beim japanischen Publikum vorausgesetzt werden kann. […] Zweites ist dem Europäer der Sittenkodex, der dem Schauspiel zugrunde liegt, fremd. Das Stück, das 1746 zum ersten Mal aufgeführt wurde, ist ganz im Geist des Bushido, der Kriegerethik der Tokugawa-Zeit geschrieben. Für den Samurai galt die Loyalität dem Lehnsherrn gegenüber […] als oberstes Gesetz; selbst familiäre Pflichten und Rücksichten wurden der Vasallentreue untergeordnet. (ebd.: 63f.)
Um dem Schicksal der Gersdorff’schen Fassung zu entgehen, die für das deutsche Publikum nicht verständlich sein konnte, da dieser auf die „Schwierigkeiten europäischer Zuschauer“ (ebd.: 64) eben keine Rücksicht genommen hatte, transponierte Klabund das Thema rigoros in seine Zeit:
Takeda Izumo lieferte ihm bühnenwirksame Szenen für ein Spiel, in dem das Problem des Gottkaisertums und die Frage nach dem Wert oder Unwert des Opfers in exotischem Gewand behandelt werden. […] Klabund ersetzte […] das historische Motiv der Vasallentreue [dabei] durch den Elitegedanken Nietzsches. […] Klabund wollte zeigen, dass es nicht die Pflicht der „Vielzuvielen“ ist, sich für einen Übermenschen, einen Gottkaiser zu opfern. […] Klabund motiviert den Selbstmord Kwans weder mit christlichen noch mit sozialen Ideen, sondern mit ganz persönlichen Gefühlen. Kwan will der Geliebten an Opfermut nicht nachstehen. (ebd.: 66f.)
Nach solchen Befunden macht es keinen rechten Sinn, Klabund noch vorzuhalten, die dem deutschen Publikum an und für sich schon unverständliche Idee des Stückes und damit natürlich den „Geist des japanischen Stückes“ (ebd.) verändert zu haben. Er folgte dem Geist seiner intendierten Aussage. Dass das Stück bei Publikum und Kritik durchfiel, steht auf einem anderen Blatt.
Aus dem Persischen
1. Das Sinngedicht des persischen Zeltmachers. Neue Vierzeiler nach Omar Khayyâm (1917)
Omar Khayyâm (1048–1131; Khayyâm bedeutet nach Klabund „Zeltmacher“) war ein persischer Mathematiker, Astronom, Astrologe, Philosoph und Dichter und ist – so heißt es bei Klabund –
durch des Ewald Fitzgerald englische Nachdichtung seines Rubaijat, die erstmals 1859 erschien, in der Schätzung Westeuropas zu einem der berühmtesten östlichen Dichter geworden, während man ihn vorher nur als mathematische oder lyrische Kuriosität zu schätzen wußte. […] Die losen Beziehungen, die in den Rubaijat des Omar zwischen Dichtung und Dichter zu bestehen scheinen, die seine Verse wie Wolken umschweben, seine Gedanken wie Schmetterlinge irren lassen – verlocken wie keine andere Dichtung der Weltliteratur zu freiester Nachdichtung. […] Vorliegender Versuch der Schaffung eines neuen deutschen, nicht auf Fitzgerald beruhenden Omar, geht auf die freundliche Anregung meines Verlegers Dr. Albert Mundt zurück. (Klabund 2001: 291)
Auf der Grundlage u. a. der Übersetzungen von Edward Fitzgerald (1809–1883) und S. H. Whinfield (1836–1922) sowie der deutschen Übertragungen von Adolf Friedrich Graf von Schack (1815–1894):
wurde im Gegensatz zum mehr englisch-moralisierenden Omar des Fitzgerald die intuitive Rekonstruktion eines (selten gesehenen, aber gewiß gewesenen) rebellisch-schwärmerischen Omar erstrebt. Die Methode des Fitzgerald [aus den inhaltlich nicht zusammenhängenden Vierzeilern Omars, H. P. H.]: ein einheitliches Gedicht zu erdenken, wurde beibehalten; die Reimform des Rubaijat abaa in die deutsche Reimform abab verändert. Irgendwelche Erläuterungen bedürfen meine Verse nicht. (Ebd.)
Wie Fitzgerald ordnet Klabund die einzelnen Vierzeiler thematisch und bezieht sie aufeinander, was zu einer zusätzlichen Eigengesetzlichkeit führt, so dass Klabunds Text mit den zugrunde gelegten „Übersetzungen“, etwa von Schack, oft nur noch über einzelne Motive zusammenhängt. Auch werden Motive aus ihrem jeweiligen Zusammenhang gelöst und in eigenen Zusammenhängen wieder zusammengefügt, ein Verfahren, das so bei anderen Gedichtbearbeitungen nicht zu beobachten ist.
2. Der Feueranbeter. Nachdichtungen des Hafis (1919)
Ich habe ihn, wie alle meine Nach- und Neudichtungen aus meinem Herzen nachgedichtet. Sein Schmerz ist mein Schmerz, sein Gelächter das meine. Und als er um Suleikas Tod weinte, da weinte auch ich um den Tod der meinen.
Ich nenne als benutzte Quellen die Hafisübersetzungen von Hammer, Nesselmann, Daumer, Rosenzweig, Bodenstedt; die Daumersche erweist sich als die bei weitem beste. Der von Bethge fehlt der Hauptreiz: der Reim, den Hafis besonders kunstvoll handhabte. (Ebd.: 311)
Wie schon bei den Gedichten Omar Khayyâms ist auch hier eine übersetzungskritische Sichtung der Nachdichtungen Klabunds schwierig, da die Gedichte des Hafis, die in großer Anzahl in Übersetzung vorliegen, keine Titel tragen und Klabund sich so weit von den Ausgangstexten entfernt, dass meist nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, welche Ausgangsübersetzung seinem jeweiligen Text Pate stand. Dennoch sind diese Veränderungen keineswegs willkürlich, im Gegenteil. Erneut und vertieft können hier das Verfahren und die Struktur der Gegen-über-setzung bei Klabund sichtbar werden.
Daumer (1846: 118) Nie, Hafis, du lieblicher Papagei Aus der Liebe goldenem Dschinnistane, Fehl' es deinem Schnabel an Koseglücks, Näscherei und süßem Marzipane. – Wehe, weh uns Armen! Ach, es geht Mit dem Turban auch der Kopf verloren! Doch, so wie er uns vom Rumpfe rollt, Gegen uns, was sind die Tamerlane? – Fernehin aufsuchte des Lebens Quell Alexander – er hat ihn nicht gekostet; Wir, wir kosten ihn im Vaterland Bei der Schenke grauem Guardiane. – Lüstet dich zu wühlen im Lockenhaar Eines holden, jugendlichen Hauptes, Nicht um Urlaub flehe die Vernunft! Nichts erflehst du von dem Paviane. Dünken ein allzu leichtes, luftiges, Lustiges Gesindel dir Poeten – Mit dem Blute des Herzens füttern sie Ihre Versebrut, die Pelikane. – Singt Hafis sein zauberisches Lied, Nüchterne taumeln ihm und Trunkne tanzen; Auf dem Reichspallaste der Poesie Wehet er als Pracht- und Ehrenfahne.
Klabund Nachts zuweilen überfällt im Traum Mich ein blauer Zauber-Wahn. Kupplig wölbt sich überm Sternenraum Dschinnistan, Dschinnistan. Flötet nicht der Papagei? Schluchzt im Walde nicht der Pavian? Und mein Herz zerreißt im Schrei: Dschinnistan, Dschinnistan ... Streichelt mich das Rieseln eines Quells? Trinkt mein Herzblut nicht der Pelikan? Eine weiße Frau entsteigt dem Fels Dschinnistan, Dschinnistan ... Träne tropft auf Träne mir herab, Ach schon kräht im Hof der erste Hahn. Und ich sinke knieend auf dein Grab ... Dschinnistan, Dschinnistan ...
Der „Liebe goldnes Dschinnistan“, das bei Klabund refrainartig wiederholt zu einem Sehnsuchtsruf wird, ist im Orient zunächst eine an Arkadien gemahnende Landschaft der Einheit von Mensch und Natur:
Jenseits Mardin, zwischen Nisibin (dem Anthemusia der Griechen) und Mussul, erstreckt sich das Land Sindschar-Dagh (Ketten-Berg), so genannt von einem Höhenzuge, der die Mesopotamische Ebene im Süden von Mardin schneidet. Man kennt den Sindschar-Dagh auch unter dem Namen Dschinnistan (Region der Genien). Dieses Land hat Ueberfluß an Quellen und vortrefflichen Weiden. Die Aprikosen, die Feigen und Weintrauben von Sindschar sind in ganz Kleinasien berühmt. (Kurdistan 1839: 325f.)
Längst jedoch ist das orientalische Dschinnistan auch Symbol einer Begegnung der deutschen mit der orientalischen Literatur geworden, wie z. B. in einer Märchendichtung von Wieland (1786) und einem Spätwerk Karl Mays (1909). Bei Klabund wird aus dem einfachen Gesang an Hafis, der, wie in vielen seiner Gedichte, auch als Selbstansprache gelesen werden kann, und der Feier seiner Dichtung ein modernes Gedicht, in dem Hafis und das lyrische Ich seines Nachdichters im Erlebnis der Poesie scheinbar eins werden, in dem der Nachdichter sich die Welt der Vorlage zu eigen macht (überfällt mich, mein Herz zerreißt, streichelt mich, mein Herzblut) und die rhetorische (Selbst-)Ansprache an Hafis in ein „Ich“ verinnerlicht; aber nur solange das „zauberische Lied“ klingt, solange der „Traum“, die spukhaft-romantische Nachtszene, dauert.
Ist in der Vorlage Hafis noch ein „Papagei“ in der „Liebe goldnem Dschinnistane“, ist die arkadische Einheit von Welt und Mensch/Dichter noch intakt, wird Dschinnistan bei Klabund ein den „Sternenraum“ überziehender „blauer [die „blaue Blume“ von Novalis klingt an] Zauber-Wahn“. Im „Traum“, der auch das Traumland der Einheit von Original und Übersetzung ist, verbinden sich Hafis und sein Nachdichter: Sie werden eins und doch nicht eins, die Unterschiede sind deutlich, die verschiedenen Traditionen klingen an, am deutlichsten in der (deutschen) Spukgestalt der „weißen Frau“. Der persische Dichter erfährt im deutschen Gegen-über-setzer eine (erneute) Individuation, eine Gemeinschaft, die aber auf den Traum der (Nach)Dichtung beschränkt bleibt: Mit dem sehr expressionistischen Ausdruck „Mein Herz zerreißt im Schrei“ ist die zeitliche Distanz von Arkadien und Moderne stilistisch auf die Spitze getrieben, mit dem Krähen des Hahns geht die Traumnacht zu Ende, der Gegen-über-setzer „sinkt kniend an dein Grab“, an das Grab des Hafis, die geträumte Gemeinschaft ist zu Ende, das Bewusstsein der nicht überwindbaren zeitlichen und inhaltlichen Differenz zum „Original“ wird als Trauer und Ernüchterung sichtbar.
Dass Klabund der Nachdichtung dieses auf den ersten Blick eher konventionellen Gedichts die Poetologie der Gegen-über-setzung einschreibt, zeigt, dass seine Adaptionen, bei allen Lässlichkeiten, doch mehr sind als Wohlklang und Exotismus.
Anmerkungen
- 1Poésies de l’époque des Thang (VIIe, VIIIe et IXe siècles de notre ère), traduites du chinois, avec une étude sur l’art poétique en Chine, 1862. Réédition partielle: Écoutez là-bas, sous les rayons de la lune, traduction de Li Bai et notes par le marquis d’Hervey Saint-Denis, révisées par Céline Pillon, 2004. Weitere Übersetzungen, auf die sich Klabund bezieht: Judith Gautier, Le livre de Jade, Paris 1867; Charles-Joseph de Harlez de Deulin, La poésie chinoise, Académie royale des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts, Bruxelles 1892. – Darüber hinaus hat Klabund seine Übertragungen u. a. von „gründlichen Kennern des Chinesischen“ wie dem Juristen und Privatgelehrten Hans Mortan (1864–1940), der unter dem Pseudonym Hans Rudelsberger Anfang des 20. Jahrhunderts Übersetzungen v. a. chinesischer Novellen veröffentlicht hat, durchsehen lassen (siehe Klabund 1928, zit. nach Klabund 2003: Bd. 8, 393).
- 2Für eine ausführlichere Diskussion von zusätzlichen Beispielen siehe: Hans Peter Hoffmann: Klabunds Nachdichtungen chinesischer Lyrik – Tempelschändung oder Gegenübersetzung? In: Andreas F. Kelletat, Aleksey Tashinskiy und Julija Boguna (Hg.): Übersetzerforschung. Neue Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Übersetzens. Berlin: Frank & Timme 2016, S. 89–106.
- 3Hierauf weist bereits Ingrid Schuster in einem Aufsatz über Klabund hin: „Verglichen mit den anderen [sinologischen, H. P. H.] Versionen jedoch kommt Klabunds Nachdichtung dem Original weitaus am nächsten – in der Stimmung, der Aussage und, nicht zuletzt, in der Form“ (Schuster 2007: 21).
- 4Die Begriffe Gegen-Übersetzung und Gegenüber-Setzung stammen von Ute Harbusch.
- 5Ausführliche Darstellungen zu den dramaturgischen Eingriffen Klabunds in die Vorgaben des Originaltextes finden sich in: Hsia (1977) und Forke (1927).
- 6Die Übersetzung von Suzuki und Carus (1913) unterstützt auch diese Lesung, während Legge (1891) und Goddard (1919) die gleiche Übersetzung wie Wilhelm liefern, die auch die heutige Standardübersetzung ist. Zu einer vergleichenden Nebeneinanderstellung der letzten drei genannten Fassungen, siehe: ‹https://www.yellowbridge.com/onlinelit/daodejing.php› (9. Juli 2018).
- 7Eine entsprechend gestaltete Übersetzung hat Günter Debon vorgelegt: Lao-tse – Tao-Tê-King, Das heilige Buch vom Weg und von der Tugend. Stuttgart: Reclam 1961 (RUB Bd. 6798).
- 8Online unter: ‹http://www.xuefo.net/nr/article33/334181.html› (12. Juli 2018).
- 9Der Text der französischen Übersetzung ist zu finden unter: ‹https://www.chineancienne.fr/traductions/le-livre-des-récompenses-et-des-peines-trad-abel-rémusat/› (12. Juli 2018).