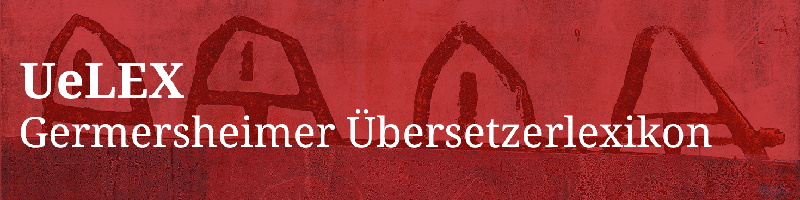Ferdinand Freiligrath (1810–1876)
„Vernachlässigt ist nach wie vor dagegen die Übersetzungstätigkeit geblieben“ (Hartkopf 1977: 487). So endet ein Forschungsbericht zu Ferdinand Freiligrath, der 1977 veröffentlicht wurde und dem auch heute nur wenig entgegenzusetzen ist, und dies, obwohl in Ferdinand Freiligraths Schaffen eigene Textproduktion und Übersetzung eng verzahnt sind (vgl. bereits Richter 1899). Hinzu kommt noch – etwas weniger umfangreich – die Herausgebertätigkeit. Allen drei Tätigkeiten gemein ist, dass sie sich fast ausschließlich um eine Gattung drehen – die Lyrik.
Als Sohn eines Grundschullehrers und Halbwaise (die Mutter starb 1817) fehlten Ferdinand Freiligrath die Mittel für ein Studium seiner Wahl.1Zum Folgenden vgl. Carrière 1877 und Giel 2008. Sein Vater schickte ihn, nach Abbruch des Gymnasialunterrichts in Detmold, zu einem Onkel in Soest, wo er eine Kaufmannslehre absolvierte. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen entwickelte Ferdinand früh eine Liebe zur Lyrik. Bereits mit 19 Jahren veröffentlichte er erste Gedichte in westfälischen Lokalzeitungen. Der literarische Durchbruch gelang 1838 mit der Veröffentlichung des Bandes Gedichte, das neben eigenen, häufig exotisierenden Gedichten – Freiligrath sprach später von „Wüsten- und Löwenpoesie“ – auch Übersetzungen französischer und englischer Lyrik enthielt.
1841 heiratete Freiligrath die Weimarer Professorentochter Ida Melos, mit der er sechs Kinder hatte und die ihn in seiner Arbeit unterstützte. Ab 1842 bezog Freiligrath, der lange Zeit im Rheinland lebte, eine Dichterpension des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV., auf die er schon nach kurzer Zeit verzichtete, da er sich ab 1843 der gemäßigt liberalen Opposition anschloss. Im Exil in Belgien, wo er Karl Marx kennenlernte, und in der Schweiz entwickelte er eine revolutionär-demokratische Haltung, die u. a. in der Sammlung politischer Gedichte mit dem Titel Ça ira (1846) zum Ausdruck kam. Nach einer kaufmännischen Tätigkeit in London kehrte er im Mai 1848 ins Rheinland zurück, um sich der revolutionären Bewegung anzuschließen. In der Folgezeit arbeitet er mit Karl Marx in der Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung und veröffentlicht einige berühmte Revolutionsgedichte, die ihm die Bezeichnung „Trompeter der Revolution“ eintrugen. Aufgrund eines Haftbefehls ging er 1851 erneut ins Exil nach London. In den kommenden Jahren entfernte er sich nach und nach von der Arbeiterbewegung. Schriftstellerischer Erfolg blieb ihm in dieser Phase weitgehend versagt. 1868 kehrte er nach Deutschland zurück. Eine Nationaldotation ermöglichte dem nunmehr berühmten, ehemaligen Revolutionsdichter einen Lebensabend ohne materielle Sorgen, den er in Stuttgart und Cannstadt verbrachte.
Übersetzungen machen einen großen Anteil an Freiligraths Werk aus. Nach Angaben von Unger (1996: 537) liegt in Freiligrath-Werkausgaben „das Verhältnis von übersetzten zu eigenen Gedichten der Anzahl nach bei etwa 4:3“. Den Eifer, mit dem er sich seinen Übersetzungen widmete, begründete Freiligrath in einem Brief an Adelheit von Stolterfoth folgendermaßen:
… und schelten Sie mich nicht, wie andere Leute, daß ich so viel übersetze. Ich glaube nun einmal die Gabe der poetischen Uebersetzung in einem Grade zu besitzen, der es mir zur Pflicht macht, sie nicht brach liegen zu lassen: sondern durch sie nach Kräften zur Vermittlung bedeutender ausländischer Talente bei unsern Landsleuten beizutragen. (Trübner 1981: 220)
Am liebsten übersetzte Freiligrath Texte, die noch nicht ins Deutsche übersetzt waren:
Ungern übersetzte er etwas, was vorher schon von anderen übertragen worden war. Dies zeigt sich besonders deutlich, als Bodenstedt ihn zur Teilnahme an einer neuen Shakespeare-Übersetzung überreden wollte. Unter keinen Umständen erklärte er sich bereit, eines der bereits von Schlegel übersetzten Stücke zu übernehmen. (Trübner 1981: 225)
Freiligrath hat vorwiegend aus dem Englischen und dem Französischen übersetzt – gelegentlich auch aus dem Italienischen (vgl. Albrecht/Plack 2018: 345) – wobei zunächst, in den 1830er Jahren, der Schwerpunkt auf dem Französischen lag und später auf dem Englischen. Ich werde mich im Folgenden auf einige in Buchform publizierte Übersetzungen beschränken, zunächst auf einen Band mit Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen, anschließend werde ich auf einige wichtige separat publizierte Übersetzungen eingehen. Auf die zahlreichen in Periodika publizierten Übersetzungen einzelner Gedichte (vgl. Fleischhak 1990: 59ff.) werde ich aus Platzgründen nicht eingehen.
Wie bereits erwähnt, enthielt der Band Gedichte aus dem Jahr 1838 nicht nur eigene Gedichte, sondern auch Übersetzungen aus dem Französischen und dem Englischen, und zwar von Alfonse de Lamartine, Jean Reboul, Alfred de Musset, Marceline Desbordes-Valmore (aus dem Französischen) sowie Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, Charles Lamb, John Keats, Thomas Campbell, Felicia Hemans, Walter Scott, Thomas Moore und Robert Burns (aus dem Englischen). Die Übersetzungen aus dem Englischen überwiegen sowohl hinsichtlich der Anzahl der Autoren als auch im Hinblick auf die Druckseiten (mehr als 100 Druckseiten vs. ca. 50 Druckseiten). Gemeinsam ist der Schwerpunkt auf neueren Autoren. Der Band war ein großer Publikumserfolg. Hierzu schreibt Volker Giel im Killy Literaturlexikon:
Obwohl die Hälfte des Bandes lediglich aus Übersetzungen englischer u. frz. Lyrik bestand, war der Erfolg spektakulär. Jedes Jahr erschien mindestens eine Nachauflage, insg. fast 40 bis zu F.s Tod 1876. (Giel 2008: 566)
Unter den Übersetzungen aus dem Französischen spielen Übersetzungen von Gedichten Victor Hugos eine besondere Rolle. Freiligrath hat Übersetzungen zu mehreren Bänden einer deutschen Werkausgabe Hugos beigetragen. Wie aus dem folgenden Brief Freiligraths vom 24. August 1835 an seinen Freund Heinrich Jerrentrup hervorgeht, hatte der Verleger Sauerländer Freiligrath die Übersetzung angeboten:
Buchhändler Sauerländer in Frankfurt a.M. hat mir vor drei Wochen für eine in seinem Verlage erscheinende Uebersetzung der sämmtlichen Werke Victor Hugo’s unter den schmeichelhaftesten Ausdrücken und zu einem Honorar von 22 Friedrichsdor die Odes et Poésies diverses angetragen. Die Arbeit muß Ende Oktober fertig sein. Ich habe zugesagt, arbeite des Nachts wie toll, und ein Theil des Manuscriptes ist schon in Frankfurt. (Buchner 1881: 126)
Der Band Oden und vermischte Gedichte erschien 1836 als Band 9 der Werkausgabe. Noch im gleichen Jahr erschien Band 11, zu dem Freiligrath die Dämmerungsgesänge beitrug. 1838 erschien Band 16, Orientalen und Balladen, mit einigen Übersetzungen von Freiligrath. In einem Brief an Karl Immermann vom 24. Juli 1838 schreibt er zu seinen Hugo-Übersetzungen:
Meine Uebersetzungen aus Hugo kennen Sie wohl nicht, und ich erlaube mir daher, sie beizulegen. Sie sind nächtlicher Weise in sehr kurzer Frist entstanden, und darum stellenweis etwas sehr ungefüge, rauh und polternd. Vieles ist jedoch auch auf die entsetzliche Correctur zu schieben, namentlich rücksichtlich der Interpunction. (Buchner 1881: 216f.)
Im Jahr 1845 erschien der Band Lyrische Gedichte mit einer Sammlung aus Freiligraths Hugo-Übersetzungen, die für diesen Zweck z. T. überarbeitet wurden:
Das vorliegende Bändchen beabsichtigt keineswegs eine vollständige Vertretung der Hugo’schen Lyrik, sondern giebt zunächst nur aus denjenigen Liedersammlungen des französischen Dichters, welche ich jetzt vor fast zehn Jahren für die Sauerländer’sche Gesammtausgabe von Hugo’s Werken übersetzte, eine Reihenfolge ausgewählter, sorgfältig durchgesehener und da, wo es mir nöthig schien, wesentlich verbesserter Stücke. (Freiligrath 1845: V)
Kurt Richter beschreibt in seiner Monographie Ferdinand Freiligrath als Uebersetzer die vorgenommenen Veränderungen in dieser Sammlung und einer Neuauflage von 1870 und charakterisiert Freiligraths Arbeitsweise folgendermaßen: „Man ersieht aus diesen Einzelheiten, dass es Freiligrath sehr ernst mit seinen Uebersetzungen nahm“ (Richter 1899: 9). Richter analysiert in der Folge einzelne Übersetzungen im Detail und lobt deren sprachliche und literarische Vorzüge, auch im Vergleich zu anderen deutschen Hugo-Übersetzungen. Allerdings kritisiert er den Gebrauch einiger Fremdwörter in den Übersetzungen, wie z. B. Creneaux („Zinnen“), Korolle („Blumenkrone“) oder Trombe („Wasserhose“). Diese seien „den meisten Lesern wohl unverständlich“ (Richter 1899: 18). Andererseits zitiert Richter aber auch Beispiele, in denen die Übersetzung poetischer klinge als das Original, z. B. in dem Gedicht Die Fee und die Peri (Richter 1899: 18):
Viens, bel enfant! Je suis la Fée!
Je règne au bord où le soleil
Au sein de l’onde réchauffée
Se plonge éclatant et vermeil.
Des Abends Purpurwolken glühen,
Komm, schönes Kind, ich bin die Fee!
Ich herrsche, wo der Sonne Sprühen
Hinabzischt Abends in die See.
Ernst Breitfeld zitiert einige Fälle, in denen Freiligrath Hugos Gedichte „durch grellere Ausdrücke [überbietet]“ (Breitfeld 1896: 26). So gebraucht er statt des einfachen Adjektivs rot häufig intensivierende Ausdrücke wie scharlachrot oder blutrot und fügt im folgenden Beispiel aus den Orientalen das Adjektiv blutrünstig ein: „ossements humains – blutrünstige Menschenknochen“.
Ab Ende der 1830er Jahre übersetzt Freiligrath überwiegend aus dem Englischen.2Übersetzungen einzelner Gedichte aus dem Englischen waren bereits ab Ende der 1820er Jahre entstanden. Vgl. die Dissertation von Erbach (1908), in der auch einige dieser frühen Übersetzungen abgedruckt sind. Seine Beweggründe erläutert er in einem Brief an Wolfgang Müller vom 4. März 1839:
Ich übersetze jetzt viel aus dem Englischen, meist Sachen der unbekannteren Lyriker unserer Zeit, und werd’ es binnen Kurzem im Literaturblatt zum Auslande drucken lassen. Es verlohnt sich schon der Mühe: – Keats, Shelley, Wilson, Proctor, Bowles, Kirke-White, die Hemans und Andere haben herrliche Lieder geschrieben, und es thut mir wohl, mich einmal abzuwenden von den fiebernden Franzosen und mir selbst zu der Ruhe und Sinnigkeit dieser See- und Bergdichter, deren Naturanschauung mich häufig an Schefers Laienbrevier erinnert. Shelley und ein paar Andere ausgenommen, ist über Alles, was diese neuen Engländer geschrieben, eine Stille, eine Ruhe ausgegossen, die einen unbeschreiblichen Zauber auf mich ausübt und mich unwiderstehlich zum Dollmetschen auffordert. (Buchner 1881: 301)
1846 erschien eine Sammlung englischer Gedichte, die Freiligrath in den 1830er und frühen 1840er Jahren übersetzt hatte, unter dem Titel Englische Gedichte aus neuerer Zeit. Im Vorwort dieses Bandes findet sich der lapidare Hinweis: „Die im Inhalt mit einem Sternchen bezeichneten Stücke hat meine Frau übersetzt“ (Freiligrath 1846: VI). Dabei handelt es sich um zehn von 80 Gedichten des Bandes, neun davon sind Übersetzungen von Gedichten der damals sehr populären romantischen Dichterin Felicia Hemans, ein weiteres betrifft ein Gedicht von Henry W. Longfellow, mit dem Freiligrath freundschaftlich verbunden war (vgl. Appelmann 1915: 64).
Im Jahr 1849 erschien bei Scheller in Düsseldorf eine weitere Übersetzung aus dem Englischen, die eine Besonderheit in Freiligraths übersetzerischen Werk darstellt, da er eine Vorliebe für zeitgenössische Dichter hatte: eine Übersetzung von Venus und Adonis. Im Vorwort zu seiner Übersetzung schreibt er:
Die deutsche Literatur besitzt keine Übersetzung der erzählenden Gedichte Shakespeare’s welche den Uebersetzungen der Dramen durch Schlegel-Tieck und der Sonette durch Regis ebenbürtig zur Seite treten könnte. Ich habe versucht, diesem Mangel abzuhelfen, und übergebe dem Publikum hiermit vorläufig Venus und Adonis. (Freiligrath 1849)
Die Verwendung des Adverbs vorläufig ist hier nicht als Bescheidenheitsfloskel zu verstehen, sondern dokumentiert einmal mehr Freiligraths selbstkritische Haltung. Hierzu schreibt Josef Ruland:
An der Übertragung der Verserzählung Venus und Adonis nach Shakespeare feilte und korrigierte der Dichter mehr als zwölf Jahre. Es ging ihm darum, Wohllaut und Rhythmus eines jeden Gedichts unbedingt zu erhalten, dabei aber die Worttreue keineswegs zu vernachlässigen. Daher erklärt sich auch seine vergleichsweise langsame Arbeitsweise. (Ruland 1976: 37f.)
Die nächste Publikation, die ich erwähnen möchte, ist keine Übersetzung, steht aber mit Freiligraths Übersetzungstätigkeit in Verbindung: die von ihm herausgegebene Anthologie The Rose, Thistle and Shamrock. A Selection of English Poetry, Chiefly Modern (1853). Der Band versammelt Beispiele britischer und amerikanischer Lyrik von Shakespeare bis in die Gegenwart. Er erschien in Stuttgart bei Hallberger, richtete sich also an ein deutsches Publikum, d. h. die Anthologie sollte, ähnlich wie Freiligraths Übersetzungen, die englische Lyrik einem deutschen Publikum näherbringen. Offenkundig gab es Mitte des 19. Jahrhunderts genügend Leser für einen solchen Sammelband, denn zu Freiligraths Lebzeiten erschienen vier Neuauflagen (vgl. Spink 1925: 42).
1856 erschien Freiligraths Übersetzung des epischen Gedichtes The Song of Hiawatha von Henry Wadsworth Longfellow. Die Anregung zu der Übersetzung kam von Longfellow selbst, mit dem Freiligrath bereits seit Anfang der 1840er Jahre eine persönliche Freundschaft verband:
Kurz nach Beendigung der handschriftlichen Aufzeichnung, am 25. April 1855, schrieb Longfellow an Freiligrath, daß bald sein neuestes Werk Hiawatha im Druck erscheinen werde und sprach die Hoffnung aus, daß es ihm gefallen möge. Diese Hoffnung sollte sich in ungeahnter Weise erfüllen; denn kaum hatte Freiligrath das erste Druckexemplar des Hiawatha erhalten, als er in heller Begeisterung für dieses wald- und wiesenduftende Indianerepos seine Übersetzung begann, die bruchstückweise im Morgenblatt veröffentlicht wurde, bis das ganze Werk noch im Laufe des Jahres 1856 bei Cotta, Stuttgart, erschien. (Appelmann 1915: 79)
Freiligrath, der strukturelle Ähnlichkeiten zu dem finnischen Epos Kalevala erkannte, drückte seine Wertschätzung im Vorwort seiner Übersetzung folgendermaßen aus:
In dem Pantheon der Weltpoesie, an dem wir seit Herder fort und fort bauen in unserer Literatur, durfte, meines Erachtens, der Sang von Hiawatha nicht fehlen. Ich entschloß mich darum gleich nach dem Erscheinen des Gedichts zu einer Uebersetzung desselben […]. (Freiligrath 1857: XII)
Wie in anderen Übersetzungen, so versucht Freiligrath auch hier die sprachlichen Besonderheiten des Ausgangstextes nachzubilden, insbesondere die zahlreichen Alliterationen, wie „Rusch und Röhricht“ für „reeds and rushes“ oder „wild und wirblig“ für „wild and wayward“. Da dies nicht an allen Textstellen gelang, führte er an anderen Stellen als Kompensation neue Alliterationen in den Text ein, z. B. „Finsternis des Forstes“ für „shadow of the forest“ (Appelmann 1915: 85). Richter weist zudem darauf hin, dass Freiligrath an einigen Textstellen auch poetische Neologismen eingeführt habe. So übersetzt er comet mit dem metaphorischen Ausdruck Bartstern (Richter 1899: 86).3Laut DWDS ist dieser Ausdruck allerdings bereits bei Jean Paul belegt.
Diese Übersetzung markiert eine Zäsur in Freiligraths Schaffen. Hierzu noch einmal Kurt Richter:
Nach der Veröffentlichung des Sanges von Hiawatha versiegt der Quell der Poesie immer mehr in Freiligrath, bis ihn nach langen Jahren des Stillstandes die Ereignisse von 1866 und 1870/71 in neuer, ungeschwächter Kraft hervorsprudeln lassen. (Richter 1899: 90)
In dieser letzten Schaffensperiode entstehen keine umfangreicheren Sammlungen in Buchform mehr, jedoch einige viel beachtete Übersetzungen einzelner Gedichte von bisher in Deutschland wenig bekannten amerikanischen Dichtern: 1868 publizierte Freiligrath zehn Übersetzungen von Gedichten Whitmans und 1872 elf Übersetzungen von Gedichten Hartes (vgl. Richter 1899: 92ff.).
Abschließend sei noch auf ein Kuriosum hingewiesen. 1850 erschien eine der wenigen Übersetzungen eines Prosatextes, die Freiligrath veröffentlicht hat, die Übersetzung eines politischen Textes: der Katechismus des Proletariers, eine 16-seitige Flugschrift, die auf einem französischen Ausgangstext von Victor Tedesco, eines „frühen Gefährten von Karl Marx in Belgien“ (Kern 2014), beruht. In Freiligraths Übersetzung wird das moderate Pathos des Originals durch verschiedene Verfahren (Ausrufezeichen, Interjektionen, Konkretisierungen) merklich erhöht, wie im folgenden Ausschnitt:
Drapeau de nos pères marchant à la destruction de la Société féodale, reçois le serment du prolétaire. Dans sa lutte ardente contre l’aristocratie nouvelle, protège son cœur de toute défaillance. Prophétie de l’avenir, éclaire son intelligence et préserve-la des promesses décevantes de ses ennemies. (Tedesco 1849 [1849]: 761)
Fahne unsrer Väter, die ihnen beim Umsturz der Feudalgesellschaft voran wehte, höre den Schwur des Proletariers! Schütze, in seinem heißen Kampfe gegen die neue Aristokratie, schütze sein Herz vor jedem Ermatten! Erleuchte, o Prophetin der Zukunft, seinen Geist, daß er gewappnet sei gegen alle trügerischen Verheißungen seiner Feinde. (Tedesco/Freiligrath 1849/1850: 16)
In Freiligraths Übersetzung wird u. a. konkretisiert, dass die Fahne der Väter weht und dass sie den Schwur des Proletariers hört, und aus der abstrakten Prophezeihung wird eine personifizierte Prophetin, die zudem vokativisch angesprochen wird. Es überrascht daher nicht, dass diese Übersetzung für die Arbeiterbewegung ein „vortreffliches Propagandamittel für Deutschland“ (Kern 2014: 636) war.
Was die Rezeption von Freiligraths Übersetzungen angeht, so weist Unger darauf hin, dass sich Freiligraths Neigung zu einführenden Erstübersetzungen positiv auf die langfristige Rezeption der Übersetzungen auswirkte:
Und in der Tat sind zahlreiche Lyriker in Deutschland durch Erstübersetzungen Freiligraths bekannt geworden, darunter Felicia Hemans, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, Alfred Tennyson sowie später die Amerikaner Walt Whitman und Bret Harte. Es überrascht daher nicht, daß seine Übersetzungen noch bis weit ins 20. Jahrhundert in Anthologien nachgedruckt werden. [Fußnote:] Ernst Fleischhaks Bibliographie verzeichnet bis 1990 127 Anthologien, in denen Freiligrath mit Gedichten oder Übersetzungen vertreten ist. (Unger 1996: 538)
Wie bereits zu Beginn erwähnt, werden Freiligraths Übersetzungen in der Freiligrath-Forschung vergleichsweise stiefmütterlich behandelt. Eine frühe Ausnahme ist die Monographie von Kurt Richter aus dem Jahr 1899. Zu den besonderen Forschungsdesiderata im Zusammenhang mit Freiligraths Übersetzungstätigkeit zählt aus meiner Sicht die genauere Erforschung des Anteils seiner Ehefrau Ida an seiner Übersetzungstätigkeit. Hierzu liefert die Sekundärliteratur bisher nur wenige Hinweise.
Anmerkungen
- 1Zum Folgenden vgl. Carrière 1877 und Giel 2008.
- 2Übersetzungen einzelner Gedichte aus dem Englischen waren bereits ab Ende der 1820er Jahre entstanden. Vgl. die Dissertation von Erbach (1908), in der auch einige dieser frühen Übersetzungen abgedruckt sind.
- 3Laut DWDS ist dieser Ausdruck allerdings bereits bei Jean Paul belegt.