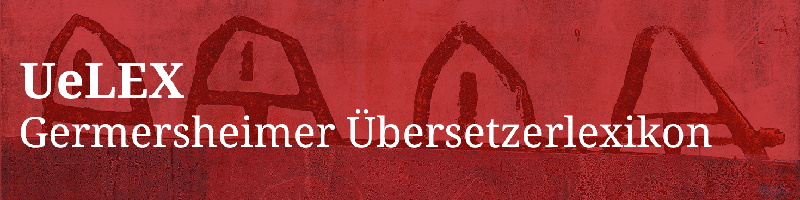Rosa Schapire, 1874–1954
Rosa Schapire stammt aus einer angesehenen und wohlhabenden jüdischen Familie. Ihre Kindheit und Jugend im galizischen Brody waren durch Mehrsprachigkeit geprägt: „Deutsch und französische Elemente haben trotz des polnischen Milieus, in dem ich aufgewachsen bin, in meiner Erziehung überwogen“ (Lebenslauf Dissertation, zit. n. Wendland 1999: 594). 1893 übersiedelte sie nach Hamburg, ab 1901 studierte sie – als eine der ersten Frauen – Kunstgeschichte in Bern und Heidelberg, wo sie 1904 mit einer Arbeit über den Frankfurter Maler Morgenstern (1738–1819) promoviert wurde (Umfang 73 S.). Früh wandte sie sich der Gegenwartskunst zu, insbesondere der Künstlergruppe Die Brücke und dem Maler Schmidt-Rottluff. 1908 ließ sie sich in Hamburg nieder und arbeitete freiberuflich als Autorin, Kritikerin, Kunstsammlerin und -vermittlerin. 1916 gründete sie gemeinsam mit der Frauenrechtlerin Ida Dehmel den Frauenbund zur Förderung deutscher bildender Kunst und organisierte in den Folgejahren Einzelausstellungen zum graphischen Werk von Munch, Nolde, Heckel, Kirchner, Pechstein und Schmitt-Rottluff.
Nach 1933 war sie aus „rassischen“ Gründen in ihren Tätigkeiten stark eingeschränkt, sie veröffentlichte unter Pseudonymen und engagierte sich mit Vorträgen im Jüdischen Kulturbund Hamburg. Erst kurz vor Kriegsbeginn flüchtete sie als fast 65-Jährige nach England. Ihre Bibliothek und Kunstsammlung wurden von der Gestapo beschlagnahmt und versteigert, die von Schmitt-Rottluff bemalten Möbel verbrannten 1943 während eines Luftangriffs auf Hamburg.
Im englischen Exil bemühte sie sich, für den dort noch unbekannten deutschen Expressionismus Interesse zu wecken. Sie beteiligte sich in der Exilsprache Englisch an kunsthistorischen Publikationen, nach Kriegsende schrieb sie auch wieder für deutschsprachige Zeitschriften, u.a. als Londoner Korrespondentin Museums- und Ausstellungsberichte für die renommierte Weltkunst. Auch übersetzte sie gelegentlich, etwa Herbert Reads Einleitung in der in England hergestellten Broschüre zu einer vom British Council veranstalteten Henry Moore-Ausstellung (Hamburg und Düsseldorf 1950).1Zum Exil in England vgl. auch den Aufsatz von Shulamith Behr (1998). Sie starb 1954 in der Londoner Tate-Galerie nahe den von ihr gestifteten Kunstwerken.
Das Übersetzen wird in der Schapire-Literatur meist nur als Nebentätigkeit erwähnt, mit der sie (schon während des Studiums) ihren Lebensunterhalt sichern wollte. Das übersetzerische Œuvre ist indes sehr umfangreich, es umfasst in den 1920er Jahren u.a. französische Prosawerke von Balzac (Le père Goriot; Le contrat de mariage; Pierrette) und Zola (Le docteur Pascal; Son Excellence Eugène Rougon). In den Jahren zuvor hatte Schapire meist polnische Werke ins Deutsche gebracht, darunter noch vor dem ersten Weltkrieg die monumentalen, bei Georg Müller in München verlegten historischen Darstellungen des Kulturhistorikers und Politikers Casimir von Chłędowski mit Titeln wie Rom: Die Menschen der Renaissance (525 S.), Rom: Die Menschen des Barock (549 S.), Das Italien des Rokoko (501 S.).
Rosa Schapires Balzac-Übersetzung Vater Goriot wurde seit der Erstausgabe (Berlin: Rowohlt 1923) immer wieder aufgelegt, mitunter auch mit Begleittexten von Ernst Robert Curtius oder W. Somerset Maugham; 2022 erschien in der SWR-Reihe Große Werke – Große Stimmen ihre deutsche Fassung gelesen von Walter Andreas Schwarz (1913–1992) als CD-Dokument.
Ihre drei Jahre jüngere Schwester Anna Schapire (1877–1911) verließ ebenfalls zum Studium ihre Heimatstadt Brody. Sie ging nach Wien, heiratete dort 1907 den Philosophen und Ökonomen Otto Neurath. Berühmt ist ihr Abriß einer Geschichte der Frauenbewegung (1909). Wie Rosa Schapire übersetzte sie literarische und historische Werke aus dem Polnischen, Russischen und Englischen. In den beiden letzten Jahren vor ihrem frühen Tod hatte sie an Ludwik Kulczyckis dreibändiger, 1500 Seiten umfassender Geschichte der russischen Revolution gearbeitet. Die ersten Bände erschienen 1910 und 1911 noch unter ihrem Namen, den dritten Band übersetzte ihre Schwester Rosa Schapire.
Anmerkungen
- 1Zum Exil in England vgl. auch den Aufsatz von Shulamith Behr (1998).