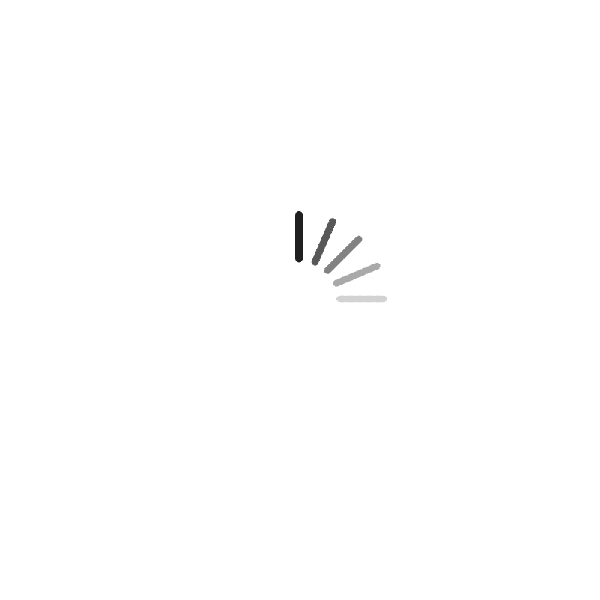August Wilhelm Schlegel, 1767–1845
August Wilhelm Schlegel gehört zu den seltenen Schriftstellern, deren Nachruhm vor allem auf ihrer Übersetzungsleistung beruht. „Mit seiner Übersetzung Shakespeares schenkte er den Deutschen ihren bis heute populärsten Bühnenautor“ – so fasst Gerhard Schulz 1983 einen über hundertjährigen Konsens zusammen. Seit Schlegel ist Shakespeare ein deutscher Dichter.
August Wilhelm Schlegel wurde am 8. September 1767 in Hannover geboren, als vierter Sohn des Predigers, Fabel- und Liederdichters und Batteux-Übersetzers Johann Adolf Schlegel (1721–1793). Dieser und sein genialer Bruder Johann Elias (1719–1749), einer der frühesten Verehrer Shakespeares, waren das erste Brüderpaar, das den Namen Schlegel in der literarischen Welt bekannt machte. Über Wilhelms Jugend und Schulzeit im hannoverschen Ratsgymnasium gibt es nur karge Andeutungen. Sie weisen auf einen strebsamen Schüler, der auf Schulfeiern lateinische Hexameter vorträgt; Latein und Griechisch dürften mehr als die Hälfte des Stundenplans eingenommen haben. 1786 bezieht er die Universität Göttingen, wechselt von der Theologie zur Klassischen Philologie, die er bei Christian Gottlob Heyne studiert, und hört den Privatdozenten Gottfried August Bürger (1747–1794). Bereits im zweiten Jahr verfasst er eine lateinische Preisschrift über die homerische Geographie (1788 gedruckt). Auch den Erwerb der lebenden Sprachen muss man wohl früh ansetzen: Schon 1789 unternimmt er mit dem Lehrer und Freund Bürger den Versuch, Shakespeares Midsummer Night’s Dream zu übersetzen, und 1791 erscheint in Bürgers Zeitschrift Akademie der schönen Redekünste die erste begeisterte Darstellung von Dantes Divina Comedia mit Übersetzungsproben.
Der junge Stubengelehrte, der sich mit eisernem Fleiß die Kenntnis der europäischen Literatur- und Kunstgeschichte von den griechischen Anfängen über das romanisch-germanische Mittelalter bis zu seiner Gegenwart erarbeitete, suchte zugleich früh die breitere Öffentlichkeit – als Literarhistoriker, Kritiker und Interpret, als Poet und Übersetzer. Er schrieb für die Jenaische Allgemeine Litteraturzeitung (300 Rezensionen), für Schillers Horen, gründete mit seinem Bruder Friedrich (1772–1829) selber die Zeitschrift Athenäum (1798–1800), und er erfand sich die Plattform der Privatvorlesung vor einem gebildeten (und zahlenden) Publikum. Schon die Berliner Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (1801–1803) wurden legendär, die Vorlesungsreihe von 1808 über Dramatische Kunst und Literatur vor den Spitzen der Wiener Gesellschaft (Schlegel selbst zählte unter seinen 250 Zuhörern allein 18 Prinzessinnen) machte ihn vollends zur europäischen Berühmtheit. In gedruckter Form (1809–11) dreimal aufgelegt und alsbald übersetzt ins Französische, Englische, Italienische, verbreitete sie die „Botschaft der deutschen Romantik an Europa“ (Körner 1929) nicht nur im Herzen des Kontinents, sondern bis nach Skandinavien, Russland, Amerika.
Für einen Philologen ungewöhnlich bunt und bewegt verlief auch Schlegels äußeres Leben. Noch während seiner Hauslehrerzeit in Amsterdam (1791–1795) rettete er seine Jugendfreundin Caroline Michaelis-Böhmer aus Haft und Verfemung und heiratete sie 1796. Im selben Jahr ließ er sich auf Einladung Schillers in Jena nieder, wo das Paar zum Zentrum des Frühromantikerkreises wurde. Die Professur an der Jenaer Universität (1798–1801) gab er mit dem Umzug nach Berlin auf – ebenso wie seine gescheiterte Ehe (Scheidung 1803).
In Berlin fand dann die schicksalhafte Begegnung mit Madame de Staël statt. Sie sammelte Material und notable Bekanntschaften für ihr Deutschlandbuch und suchte nebenher einen Lehrer für ihre Kinder. Als literarischer Berater und Erzieher der Kinder folgte Schlegel ihr 1804 nach Schloß Coppet am Genfer See und blieb in ihrem Bann bis zu ihrem Tod. Er begleitete sie auf zwei Reisen nach Italien, nach Frankreich, nochmals durch Deutschland und organisierte schließlich die abenteuerliche Flucht vor Napoleon über Wien, Kiew, Moskau, St. Petersburg nach Stockholm (1812). Während Mme de Staël weiter nach London reiste, wo 1813 endlich ihr Buch De l’Allemagne erscheinen konnte, blieb Schlegel in Schweden als schwedischer Legationsrat und Privatsekretär des Thronfolgers Bernadotte und schrieb in dieser Funktion – und nicht zum erstenmal in französischer Sprache – politische Denkschriften über Schweden und das Kontinentalsystem, über die Politik der dänischen Regierung u. a.
Mit Napoleons Sturz endete das 10jährige ‚Exil‘ Mme de Staëls, sie eilte nach dem lange entbehrten Paris und Schlegel mit ihr. Seit 1814 lernt er dort mit Hilfe französischer Orientalisten Sanskrit und studiert in der Nationalbibliothek die Literatur der Inder. Der Tod Mme de Staëls am 14. Juli 1817, die ihn noch als ihren literarischen Nachlassverwalter eingesetzt hatte, beschließt ein kompliziertes, spannungsreiches, beglückendes und quälendes, kaum ganz zu enträtselndes Verhältnis. Schlegel ist nun bereit, nach Deutschland zurückzukehren, und nimmt einen Ruf zunächst an die Universität Berlin an. Er ist auch bereit, eine zweite Ehe einzugehen, und entscheidet sich nicht zuletzt um der Familie der jungen Braut willen für die neugegründete Universität Bonn. Dass die Braut auch nach der Eheschließung ihr Heidelberger Elternhaus nicht verlassen wollte, zog Schlegel bitteren Spott zu; die Ehe wurde nie vollzogen. Im Herbst 1818 tritt Schlegel sein Amt als Professor für Literatur- und Kunstgeschichte an; es sollte die Endstation werden.
Seit Wilhelms Schwärmerei für die Glaubenseinheit des Mittelalters und besonders seit Friedrichs Konversion (1808) und Propaganda für das österreichische Kaisertum im Dienst Metternichs galten die Brüder Schlegel als „katholisch“. Wilhelm folgte jedoch dem Schritt seines Bruders nicht, sondern betonte in der Spätzeit gerne seinen Protestantismus und den Wert der Reformation. Auf die Karlsbader Beschlüsse zur Überwachung der Universitäten reagierte er 1819 mit einem Entlassungsgesuch. Er wurde beschwichtigt und erhielt vom Minister die Zusage, er könne sich künftig ganz auf seine Sanskritstudien konzentrieren. Auf Reisen nach Paris und London vertiefte er diese Studien, errichtete die erste Sanskrit-Druckerei auf deutschem Boden, gründete die Zeitschrift Indische Bibliothek (3 Bde, 1823, 1827, 1830), gab die Bhagavadgita (1823), zusammen mit seinem Schüler Christian Lassen die „berühmte editio princeps“ des Hitopadesa (1829–31) sowie die ersten beiden Bücher des Ramayana (1829–38) mit lateinischer Übersetzung und Kommentar heraus. So „wurde Bonn zur ersten deutschen Universität, an der die Sanskritphilologie heimisch wurde“ (Mylius 1983). In Bonn ist August Wilhelm Schlegel in seinem 78. Lebensjahr am 12. Mai 1845 gestorben.
Schlegels Übersetzungen sind nur eine Facette seiner umfassenden Arbeit an einer europäischen Literatur- und Geistesgeschichte. Deren theoretische Grundlagen entstanden früh, zur Hauptsache in der Jenaer Zeit, in intensivem Austausch mit dem Bruder Friedrich, der oft entwarf, was Wilhelm dann ausführte. Friedrichs Periodisierung der griechischen Literatur lieferte das historische Modell für die Evolution einer Nationalliteratur, Herders und Winckelmanns Geschichtskonzept weiterführend. Aus der vergleichenden Konfrontation von antiker und christlicher Welt entwickelten die Brüder ihren Begriff des „Romantischen“, der Mittelalter und frühe Neuzeit umspannte. Sie konturierten diese Epoche durch eine Neubewertung ihrer großen Gestalten: Dante, Shakespeare, Calderon, Cervantes (sein Projekt einer Übersetzung des Don Quichote trat August Wilhelm Schlegel an Tieck ab). Die Universalität dieser Dichter sollte Vorbild für eine wahrhaft moderne „romantische“ Poesie sein.
Dass Theorie, Geschichte und Kritik untrennbar zusammengehören, vertrat besonders nachdrücklich August Wilhelm Schlegel. Die normativen Begriffe der Theorie vom „Schönen“ und von „Vollendung“ waren zu vermitteln mit der Geschichte und ihrem „unendlichen Fortschritt“ und mit der Interpretation des individuellen Kunstwerks. „Vollendet’ kann es immer nur „in seiner Art“ sein, und diese Art ist gebunden an Zeit und Umstände. Die „Kritik“ fußte dabei auf der Anschauung des Kunstwerks als eines organischen Ganzen, dessen Form nichts bloß Äußerliches ist, sondern Ausdruck und „innere Form“. So hielt er auch die Zeitmessung in der Metrik für eines der ursprünglichsten Bedürfnisse des Menschen seit den Anfängen der Geschichte, als Musik, Tanz und Poesie noch eins waren.
Den Durchbruch zu einer neuen Übersetzungspraxis gemäß solcher Prinzipien markiert der Horen-Aufsatz „Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters“ von 1796, in dem nicht nur erstmals die Forderung nach einer „treuen und poetischen“, d. h. formgetreu-metrischen Shakespeare-Übersetzung erhoben, sondern auch das große Projekt einer Weltliteratur in deutscher Sprache skizziert wird, wozu die „vielfache Biegsamkeit“ dieser Sprache und der kosmopolitische Geist der Deutschen berufen sei. Zusammengesehen mit der ein Jahr später folgenden Interpretation von Romeo und Julia – dem ersten Beispiel dieses Genres überhaupt – rechtfertigt der Aufsatz vollkommen den bewundernden Satz Rudolf Hayms: „So wie hier […] war über ihn [Shakespeare] vorher weder in Deutschland noch in England geredet worden.“ (1870: 161)
Zur selben Zeit war August Wilhelm Schlegel längst dabei, sein Programm in die Tat umzusetzen, gefördert durch die Mitarbeit Carolines, deren Anteil allerdings kaum mehr konkret zu bestimmen ist. Bereits 1797 erschienen die ersten beiden Bände von Shakespeares dramatische Werke mit vier Stücken, bis 1801 in rascher Folge sechs weitere Bände. Ein letzter Band brachte 1810 die Zahl der übersetzten Stücke auf 17, was allerdings nicht einmal die Hälfte von Shakespeares Gesamtwerk ausmacht. Tieck und sein Team komplettierten die Reihe bis 1833 nach Schlegels Vorbild. Dass eine solche Übersetzung auch die deutsche Bühne verändern könne – hin zum klassischen Versdrama, hat Schlegel schon selber ausgesprochen. Entsprechend kommen im 20. Jahrhundert die heftigsten Angriffe gegen Schlegels Veredelung des „elisabethanischen Shakespeare“ von dramaturgischer Seite (Rothe 1961). Ein vergleichender Leser allerdings wird der Fülle glücklicher Lösungen, genialer Annäherungen, der Musikalität und gestischen Treffsicherheit der Sprache seine Bewunderung nicht versagen. Zur detaillierten Kritik und Würdigung sei auf die Arbeiten von M. Bernays, F. Jolles, P. Gebhardt, R. Paulin, K. P. Steiger und F. Apel verwiesen.
Ein weiterer Schwerpunkt des Übersetzers August Wilhelm Schlegel waren die Dichter der Romania, allen voran der verehrte Dante. 1803 sammelte Schlegel seine Übersetzungen italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie in der Anthologie Blumensträusse … (Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariost, Tasso, Guarini, Montemayor, Cervantes, Camoens). 1803 und 1809 erschienen zwei Bände Spanisches Theater mit fünf Stücken des unermüdlich gepriesenen Calderon. Sie hatten bei Weitem nicht den Erfolg der Shakespeare-Übersetzungen; mag sein, dass Schlegels Bemühen, den Filigran der spanischen Verskunst nachzubilden, hier doch die deutsche Sprache überfordert und oft ins Gekünstelte fällt.
Doch sein Ansatz der formbewahrenden Übersetzung blieb paradigmatisch. „Die Kunst der Uebersetzungen begann erst mit den Romantikern und namentlich mit A. W. Schlegels Uebertragung des Shakespeare“, schrieb 1881 Karl Goedeke (215). Als Schlegel 1810 die Ariost-Übersetzung von Johann Diederich Gries besprach, stellte er selber befriedigt fest:
Der Grundsatz ist jetzt anerkannt, daß jedes Gedicht in seiner eigenen metrischen Form, oder wenigstens in einer ihm so nahe verwandten, als die Natur der Sprache es nur irgend erlaubt, übertragen werden muß. Allein über den Grad der Annäherung im Silbenmaß, welcher ohne Gewaltthätigkeit gegen die Sprache möglich ist, finden verschiedene Meinungen statt. Wir gestehen es, wir sind überall, sowohl bei Nachbildungen aus den alten als neueren Sprachen, für die strenge Observanz. (Böcking VII: 246)
Dennoch scheute Schlegel die Extreme. In der lang anhaltenden Diskussion darüber, wie weit man gehen dürfe, um – in Schleiermachers Worten (1813, Störig 47) – den Leser dem fremdsprachigen Schriftsteller „entgegen zu bewegen“, nahm er zuletzt die vermittelnde Stellung des Praktikers ein. Anfangs, in der langen Rezension der Homerübersetzung von J.H. Voß, einem Meisterwerk der Übersetzungskritik (1796), verurteilte er noch Voß‘ Nachbildungen der griechischen Syntax als „Undeutschheit“:
Er hat sich überall an die griechische Ordnung anschmiegen wollen, nicht so nah wie möglich (dieß wäre sehr zu loben), sondern so nah wie es unserer Sprache unmöglich ist. (Böcking X: 163)
Sich einem fremden Charakter nachbildend anschmiegen können, ist nur dann ein wahres Lob, wenn man Selbständigkeit dabei zu behaupten hat und behauptet.
Bildsamkeit ohne eigenen Geist, was wäre sie anders als erklärte Nullität? (ebd.: 151f.)
In Anmerkungen zu späteren Ausgaben (zuerst 1801) beugte sich Schlegel dem breiten Erfolg der Voß’schen Manier – Sprache sei ja „wo nicht in ihrem Ursprunge, doch in ihrer entwickelten Gestalt, eine Sache der allgemeinen Übereinkunft“ (152) – und nahm seine Kritik zurück. Ein Vorbehalt bleibt indessen bestehen und führt zu einer ausgewogenen Formulierung des Auftrags an den Übersetzer so alter Texte überhaupt:
Der Zweck alles Uebersetzens der Alten ist allerdings, ihre Werke für die Zeitgenoßen neu zu beleben. Das in der Muttersprache Geschriebene spricht uns unmittelbarer an, und in so fern können poetische Übersetzungen selbst Kennern der alten Sprachen sehr schätzbar sein. Wird die Muttersprache aber in der Behandlung zu einer todten, d. h. setzt die Lesung des übersetzten Werks ein eben so mühsames und ausführliches philologisches Studium voraus, als zur vertrauten Bekanntschaft mit dem Original erfordert wird, so wäre es kürzer, die Leser gleich an dieses zu weisen. Die Aufgabe lautet daher so: die möglichste Strenge in der grammatischen und metrischen Nachbildung soll mit dem höchsten möglichen Grade freier Lebendigkeit vereinigt werden. (1804; Böcking XII: 160f.)
In seiner Voß-Kritik unterscheidet Schlegel zwischen einem Werk, das um der vollendeten Form willen geschrieben wurde, von einem solchen, das „auch einen unwillkürlichen Ausdruck seines [des Autors] inneren Selbst“ darstelle. Ersterem darf der Übersetzer stärker eingreifend zu seiner Vollendung verhelfen, letzteres aber sei sakrosankt: hier sei die strikteste Treue, oder besser „Wahrheit“ geboten. „Individualität läßt sich nicht in Stücke zerlegen.“ (Böcking X: 119)
Die Verehrung des Autors bleibt ein Schlüsselbegriff auch der Methode. „Von der tiefsten Verehrung der großen Schöpfer und Meister durchdrungen zu sein“, ist das erste „Verdienst“ des Übersetzers. Um den großen Schöpfer „aus seiner Zeit heraus“ zu verstehen, nähert der Übersetzer sich ihm teils auf dem Weg antiquarischer Forschung, teils und vor allem mit Einfühlung. „Hineinträumen muß man sich in jenes heroische, mönchische Gewirr“, heißt es im Kontext der Dante-Übersetzung, „muß Guelfe oder Ghibelline werden“. Dann aber, im Nachvollzug der großen Schöpfung, wird der Übersetzer selber Dichter. Es gehört zu Schlegels Selbstbewußtsein, „daß das objektive poetische Übersetzen ein wahres Dichten, eine neue Schöpfung sei“. (Lohner IV: 101)
Wenn heute allgemein gilt oder zumindest gelten sollte, die literarische Übersetzung sei eine eigene Kunstform und ihr Wesen nur als Gattung sui generis zu begreifen, so hat Schlegels Theorie und Praxis entscheidend zur Begründung und Durchsetzung dieser Erkenntnis beigetragen. (Gebhardt 1970: 101)